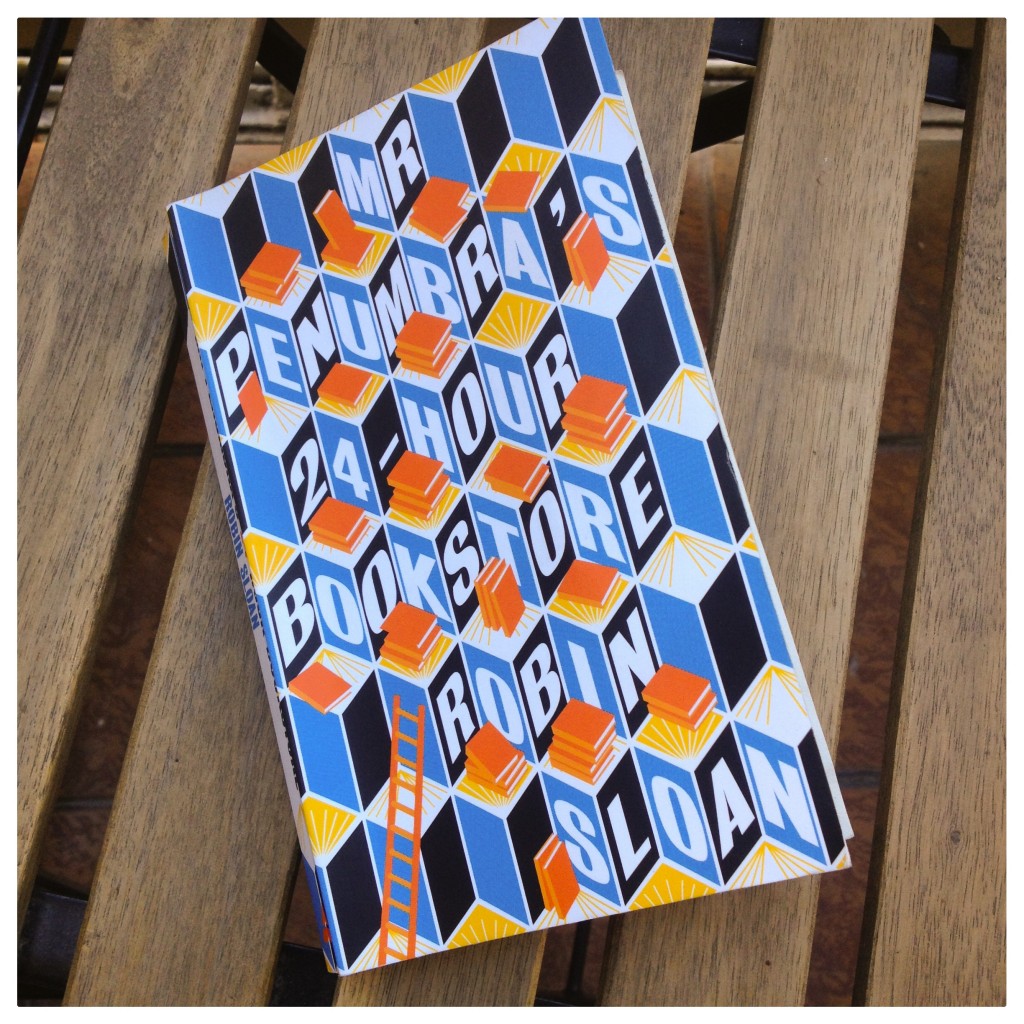Nahe der Michaelskathedrale in Kiew gibt es einen kleinen Brunnen. Pawel (der nicht wirklich Pawel heißt) hat mich hierher geführt, normalerweise ist er mit ganzen Besuchergruppen unterwegs. Aber es kommt keiner mehr nach Kiew, denn wer einen Urlaub plant, hält sich mit Feinheiten wie „in diesem Teil des Landes ist es ruhig“ eher selten auf. Freie Platzwahl im Restaurant, kaum mal eine Liftbegegnung im Hotel, Gruppenrundgang allein zu zweit.
„Nur ein Mensch diesmal“ hat Pawel eben am Telefon gesagt, es dann wieder eingesteckt und ist zum Brunnen gelaufen. Ein Wunschbrunnen, erklärt er, neben der Kathedrale mit den goldenen Dächern, die Stalin „mangels historischem Wert“ zerstören lies. Seit 15 Jahren steht sie nun wieder, in Hörweite zum Außenministerium. Vor ihm ruft ein Mann schwulenfeindliche Parolen in ein Megafon, seine Begleiter halten ein Schild hoch, das ein Hakenkreuz vor Regenbogenhintergrund zeigt. Man wüsste schon, was man sich wünschen könnte, aber im Brunnen ist kein Wasser.
 Es gab Monate, da hat man den Maidan jeden Tag in den Nachrichten gesehen. Vieles würde man auch heute noch wiedererkennen, Monate nach den Protesten und den tödlichen Schüssen. In der Sommersonne wirken die olivgrünen Zelte wie ein Pfadfinderlager, nur dass jemand „Donbass“ auf sie geschrieben hat, „Krim“ und „Mariupol“. Männer in Camouflagekleidung sitzen Wache, die übriggebliebenen der Maidanbewegung, mit unklarer Agenda. Vor den Zelten stehen Plastikdosen für Geldspenden, auf der Bühne in der Mitte treten Musiker auf, mal deklamiert auch einer Gedichte. Und dazwischen immer wieder: Grablichter, Rosenkränze, Plastikblumen, drapiert um die Fotos der Toten.
Es gab Monate, da hat man den Maidan jeden Tag in den Nachrichten gesehen. Vieles würde man auch heute noch wiedererkennen, Monate nach den Protesten und den tödlichen Schüssen. In der Sommersonne wirken die olivgrünen Zelte wie ein Pfadfinderlager, nur dass jemand „Donbass“ auf sie geschrieben hat, „Krim“ und „Mariupol“. Männer in Camouflagekleidung sitzen Wache, die übriggebliebenen der Maidanbewegung, mit unklarer Agenda. Vor den Zelten stehen Plastikdosen für Geldspenden, auf der Bühne in der Mitte treten Musiker auf, mal deklamiert auch einer Gedichte. Und dazwischen immer wieder: Grablichter, Rosenkränze, Plastikblumen, drapiert um die Fotos der Toten.
Der Wunschbrunnen muss gar nicht eingeschaltet sein, sagt Pawel. Man kann ein bisschen Wasser mitbringen und es selbst ins Becken gießen, das gilt auch.
Pawel ist halb so alt wie ich, spricht vier Sprachen, lernt gerade die fünfte, und weil sonst keiner da ist, werde ich bei unserem Rundgang alle meine Fragen los. Die Sehenswürdigkeiten kommen von selber dran, aber wie ist der Alltag? Ab wann darf man hier Auto fahren und ab wann wählen? – „18“, sagt Pawel, und schiebt direkt hinterher, dass die Präsidentschaftswahl Ende Mai seine erste war.
 Warst Du auch auf dem Maidan? Haben sich Deine Eltern keine Sorgen gemacht? Als die Schüsse fielen, sei er krank gewesen, sagt Pawel, aber ja, vorher gehörte er zu den Protestierenden. Und nein, Sorgen hätten sich die Eltern auch nicht gemacht, schließlich hatten sie ihn immer im Blick: „Sie waren ja selber auch hier.“
Warst Du auch auf dem Maidan? Haben sich Deine Eltern keine Sorgen gemacht? Als die Schüsse fielen, sei er krank gewesen, sagt Pawel, aber ja, vorher gehörte er zu den Protestierenden. Und nein, Sorgen hätten sich die Eltern auch nicht gemacht, schließlich hatten sie ihn immer im Blick: „Sie waren ja selber auch hier.“
Der Wunschbrunnen funktioniert so: Eine Münze ins Wasserbecken werfen. Dann herausfischen, an eines der Metallteile in der Mitte drücken und loslassen. Bleibt die nasse Münzen hängen, geht der Wunsch in Erfüllung.
Manchmal ist morgens auf der Maidanbühne Gottesdienst, dann ziehen die Zuhörer den Kreschatik entlang, Kiews zentrale Altstadtstraße. Sprechchöre mit „Helden“, „Ehre“ und „Erinnerung“. An der Spitze des Zuges tragen Menschen einen Sarg, vorbei an der Haltestelle, wo sonst Touristen in den Hop-on-hop-off-Bus steigen. „Wegen höherer Gewalt keine Touren bis Ende des Jahres“, steht auf der Internetseite des Busunternehmens.
Fällt die nasse Münze am Wunschbrunnen wieder runter ins Becken, erfüllt sich der Wunsch auch nicht. Manche Leute, sagt Pawel, riskieren ihre großen Wünsche darum lieber nicht und wünschen sich nur etwas Kleines.