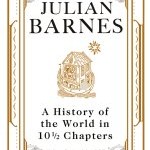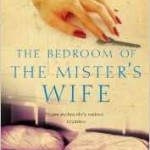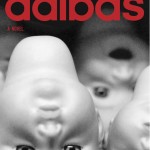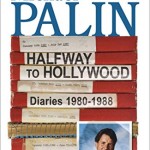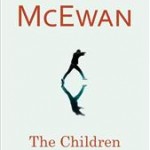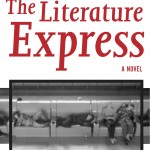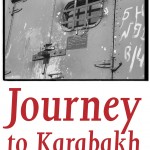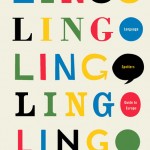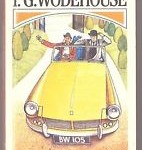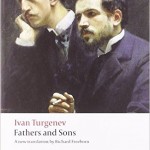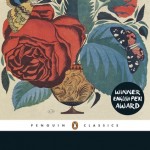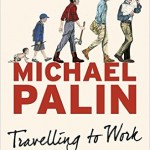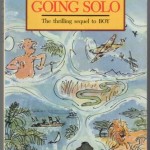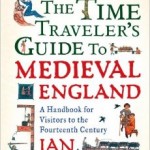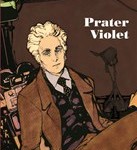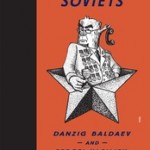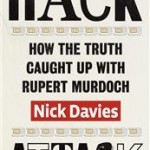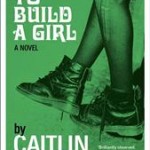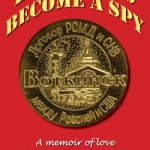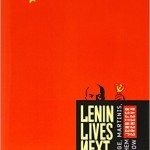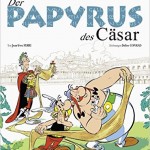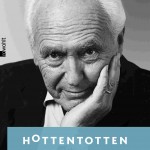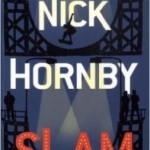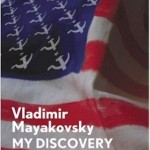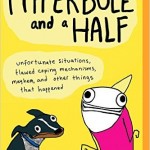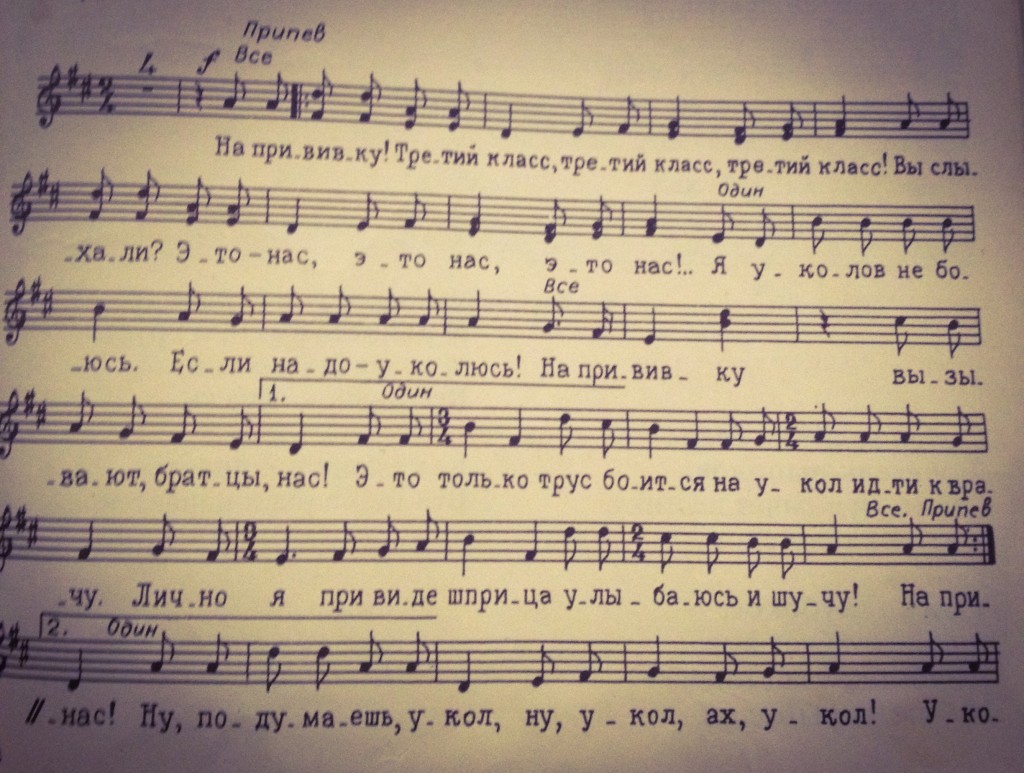Gute Vorsätze so auszuwählen, dass man sie auch einhält – das ist die Kunst. Meine Lesevorsätze für 2015 hießen also:
1. Mehr Bücher von russischen/sowjetischen Autoren – um das inzwischen nicht mehr ganz so neue Heimatland noch besser kennenzulernen.
2. Mehr Kurzgeschichten – weil „The Assassination of Margret Thatcher“ von Hilary Mantel letztes Jahr so viel Spaß gemacht hat, und weil einem Kurzgeschichten viel zu selten begegnen, wenn man sie nicht sucht.
3. Mal wieder was auf Französisch lesen – um zu gucken, ob es noch geht.
Was fehlt auf dieser gebloggten Leseliste? „Londongrad“, das ich nach den ersten Seiten abgebrochen habe (Darf man das? Sollte man sogar? Gerne hier mitreden), weil es so pseudodramatisch rüberkam wie eine Sendeplatzfülldoku über Hitlers Hunde. Und allerlei Dinge, die ich zwar gerne gelesen habe, die der Form nach aber kein Buch waren:
„Iterating Grace“ zum Beispiel, diese geheimnisvolle Erzählung, die einige Leute in den USA plötzlich als Band im Briefkasten hatten. Fanfiction, zu „Sherlock“ und, aus Gründen, zu „The West Wing“. Einen Stapel Kurzgeschichten zum Thema „Conflict“, als Jurorin für einen Wettbewerb von Red Line. (Der Siegertext, „Don’t Go Darling Boy“ von Sophie Petit-Zeman, war auch mein Favorit – lesen lohnt sich. Alle Geschichten, die es in dieser Runde auf die Shortlist geschafft haben, hier zum Nachlesen.)
Der Rest waren aber tatsächlich alles Bücher. Hier also die Liste – per Klick auf den Titel lassen sich Details ausklappen.
“Leuchtspielhaus” von Leif Randt.
„Schimmernder Dunst über Coby County“ hab ich vor ein paar Jahren
auf diesen Auftritt hin gekauft und gemocht; „Leuchtspielhaus“ liest sich ähnlich gut. Eine Londoner Hipster-Künstler-Modedesigner-Szene, die vor allem aus Nicht-Briten besteht. Darüber schwebt der Mythos um Bea, so eine Art Mischung aus Banksy und Godot, die in der Stadt Kunst hinterlässt, damit die Hipster-Künstler-Modedesigner sie dann finden und ausdeuten können. Ich weiß nicht, ob eine der Figuren auch nur einmal im ganzen Buch einen authentischen Gedanken denkt oder einen Satz sagt, ohne dessen Wirkung auf andere zu reflektieren. Aber die Sätze sind so satirisch-schön, wie sie oberflächlich sind. Existenzkrise: „Alle Katzen, die ich zeichne, scheint man schon auf T-Shirts gesehen zu haben.“ Ein Tag im Park: „Die Luft riecht gebraten; ein Pakistani verkauft eigengewerblich Würstchen.“ Zukunftspläne: „Dann male ich größere Pandas.“
“A History of the World in 10½ Chapters” von Julian Barnes.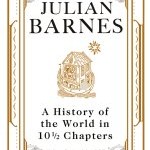
Ein Holzwurm erzählt, wie er sich auf die Arche geschmuggelt hat. Ein Schauspieler schreibt vom Dreh im Dschungel Briefe an seine Freundin. Eine Frau steigt in ein Boot und fährt los, um der Apokalypse, dem Atomkrieg oder sowas Ähnlichem zu entkommen. Die Geschichten sind nicht nur jede einzeln klasse, sondern erst recht, wenn man so ab Nummer vier oder fünf immer mehr Verbindungen und gemeinsame Themen entdeckt: Noah eben mit seiner Arche. Boote überhaupt. Gott. Bitumen. Holzwürmer. Freier Wille. Oft ist das sehr geschickt von der einen Geschichte in die andere gestrickt – und manchmal auch demonstrativ-dreist noch schnell ein Verweis drangeklatscht, im letzten Satz. Ausgelesen und am nächsten Tag schon weiterverliehen.
“The Memorial” von Christopher Isherwood.
Ein Buch im Taxi zum Flughafen in Moskau aufschlagen, am Gate weiterlesen und die letzte Seite in dem Moment umblättern, wo die Räder des Fliegers Düsseldorfer Boden berühren. So war das mit diesem Isherwood, der seine Figuren immer wieder aus anderen Blickwinkeln zeigt, dabei durch die Zeit nach dem Ersten Weltkrieg springt und zwischen Wärme und Satire diesen Ton trifft, den ich an Isherwood so mag. Bitte nicht von dem
Klappentext abschrecken lassen, den Random House dem Buch verpasst hat. Viel besser trifft es
diese Rezension: „The plot of ‚The Memorial‘ can be discussed very briefly: it doesn’t have one. It doesn’t need one. The book proceeds, not forward in time, but inward by layers. Isherwood has a wonderful gift of getting inside people.“
“Der überflüssige Mensch” von Ilija Trojanow.
Innehalten, ein paar Schritte zurücktreten und einen analytischen Blick auf das werfen, was wir für gegeben halten: Ilija Trojanow macht das in diesem Essay mit dem Kapitalismus und seinen Auswirkungen auf die Menschenwürde. Das ist oft interessant, manchmal eher nölig (alberner Seitenhieb gegen die englische Sprache) und, in seiner Kürze, eher eine Diagnose als eine Anregung, wie etwas anders laufen könnte. Am interessantesten war darum, was ich nicht aus dem Buch, sondern beim Drumherumlesen gelernt habe: dass der „
überflüssige Mensch“ eine populäre Figur in der russischen Literatur ist.
“Boy Meets Boy” von David Levithan.
Einen Schluck „
suspension of disbelief“ nehmen und schon kann man sich verlieren in dieser Highschool-Liebesgeschichte zwischen Paul und Noah. Nötig ist der Schluck, weil in ihrem Heimatort Homophobie kein Thema ist – nicht mal Boy Scouts gibt es hier, die örtliche Abteilung hat sich abgespalten und heißt jetzt Joy Scouts. (Das Buch ist aus dem Jahr 2003,
inzwischen sind die einst recht homophoben Boyscouts ein bisschen weiter.) Nach ein bisschen Eingewöhnung ist das hier jedenfalls ein Jugendbuch mit vielen originellen Figuren, das man gut lesen und noch besser jemandem im Highschool-Alter schenken kann.
“Pnin” von Vladimir Nabokov.
Wie gemein, wie toll beobachtet, wie ungewöhnlich formuliert! Eines dieser Bücher mit so vielen cleveren Wendungen und Anspielungen, dass man ständig zitieren möchte. Die Hauptfigur wird gerade zu Beginn oft als verpeilt und seltsam
vorgeführt, ehe man seine komplexeren Seiten kennenlernt. Dazu satirische
Seitenhiebe auf den
akademischen Betrieb – das war nicht mein letzter Nabokov, so viel steht fest.
“What If” von Randall Munroe.
Ja,
der Randall Munro von
xkcd hat das Buch geschrieben, es ist aus einem Nebenprojekt entstanden, bei dem ihm Leute komplett bekloppte Fragen stellen und er sie ernsthaft und nach allen Regeln der Wissenschaft beantwortet: Wenn alle Leute auf der Welt einen Laserpointer auf den Mond ausrichten, ändert sich dann dessen Farbe? (Nö.) Wie hoch kann ein Mensch einen Gegenstand werfen? (14 Giraffen hoch, wenn es ein Profisportler ist.) Was passiert, wenn man das Periodensystem nachbaut aus Ziegelsteinen, bei denen jeder aus dem entsprechenden Element ist? (Einiges, aber spätestens ab Phosphor wird es unerfreulich.) Das beste Kapitel spielt durch, was passiert, wenn man die Ozeane der Welt leerlaufen lässt: Weltherrschaft für die Niederlande!
“We” von Yevgeni Zamyatin.
Wie der Nabokov weiter oben ein Buchclubbuch, und ja: Mit den richtigen Leuten funktioniert das Prinzip, sich die Buchauswahl aus der Hand nehmen zu lassen. Vor allem, wenn die mehr Ahnung von russischer Literatur haben als ich (also ungefähr alle Leute in Moskau). Dieser totalitäre, dystopische Staat, dessen Bewohner keine Menschen mehr sein dürfen sondern nur noch Ziffern, und der nun daran arbeitet, als letztes Problem auf dem Weg zum uniformen Glück noch die Vorstellungskraft zu vernichten – das liest sich sehr eindringlich, wenn man zwischen Betonklötzen entlang geht oder mit der Metro unter der Stadt entlang rattert.
“The Bedroom of the Mister's Wife” von Philip Hensher.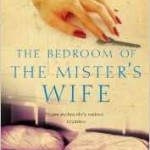
„Der war in der
Weihnachts-Promi-Staffel von University Challenge so schlau und sympathisch“ ist vielleicht kein ganz gängiger Grund, einen neuen Autor auszuprobieren. Aber auch kein schlechter. Denn solch einen Band Kurzgeschichten kann bestimmt nicht jeder schreiben, jedenfalls nicht so, dass die Geschichten gelingen: eine russische Emigrantin in Cambridge, die ihren Kühlschrank hasst, ein junges Paar, das mit dem Hauskauf das Böse in sein Leben holt, zwei Männer, die sich über eine ominöse Wer-mit-Wem-Übersicht unterhalten, die den einen seine Beziehung gekostet hat. Manches ist autobiografisch angehaucht, einmal läuft Ulrike Meinhof durchs Bild, und immer ist die nächste Geschichte wieder ganz anders. Und die Sprache so, dass ich gelegentlich besonders gelungene Stellen abtippen oder -fotografieren und wem anders schicken musste, zum Mitfreuen. Ganz abgesehen davon, dass ein Autor, der sich bei Twitter meldet, wenn ein Leser
was nicht versteht, so falsch nicht sein kann.
“Adibas” von Zaza Burchuladze.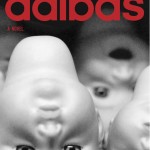
Im Vordergrund Party und Konsum, im Hintergrund Krieg. „Fiddling while Rome burns“ heißt das Prinzip das wohl im Englischen, auf Deutsch wäre es vielleicht der „Tanz auf dem Vulkan“. So ganz rund hat sich dieses Buch beim Lesen zwar nicht angefühlt, aber Zaza Burchuladze probiert immerhin viel aus, spielt mit Marken und Logos, mit verschiedenen Text-Genres einschließlich Skype-Chat und Horoskop. Dazu noch eine Ladung „Wenn ihr glaubt, meine Sprache ist obszön, solltet ihr mal überlegen, wie obszön Krieg ist.“ Nicht so richtig neu, aber eindringlich.
“Die Sache mit Tom” von Rüdiger von Fritsch.
Rüdiger von Fritsch ist unser deutscher Botschafter hier in Moskau, und nach allem, was man von ihm so mitbekommt zu Themen wie Journalismus, Pressefreiheit und Russland-Berichterstattung, fühle ich mich gut von ihm vertreten. Vor ein paar Jahren hat er aufgeschrieben, wie er 1974, kurz nach dem Abitur, seinen Cousin aus Ostdeutschland herausgeschmuggelt hat. Der Gedanke, dass jemand, der später für den Bundespräsident arbeiten und BND-Vizechef werden würde, in jungen Jahren Pässe gefälscht hat und eine Gefängnisstrafe riskiert, um jemandem zur Freiheit zu verhelfen, gefällt mir.
“Halfway to Hollywood” von Michael Palin.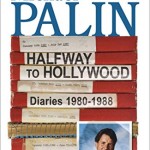
Der zweite Band der Palin-Tagebücher, wieder im Urlaub gelesen, wieder genau richtig dafür. Beim Tagebuchformat kann man so schön leicht ein- und aussteigen, es lohnt sich also, das Buch auch mal nur für zehn Minuten in die Hand zu nehmen und zu lesen, was ein intelligenter, warmherziger, lustiger Mensch über sich und seine Zeitgenossen schreibt. Ausgelesen und sofort Band drei bestellt, für den nächsten Urlaub.
“The Children Act” von Ian McEwan.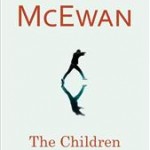
Unangenehmes Gefühl, ein Buch für unseren Buchclub vorzuschlagen und dann die einzige zu ein, der es so richtig gefällt: ein moralischer Konflikt, eine interessante, komplexe Hauptfigur in einer Sinn- und Lebenskrise, Musik als Gemeinsamkeit über Generationen hinweg und die kluge, klare McEwan-Sprache – für mich hat’s funktioniert, auch wenn ich es schwer finde, genauer zu erklären, warum. Und
„Down by the Sally Gardens“, die Schlüsselmelodie des Buchs, kann man auch gut mal kennen.
“The Literature Express” von Lasha Bugadze.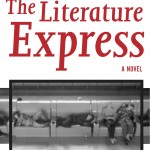
Wer jemals mit einem Stipendium im Ausland war, bei einem Seminar mit internationalen Teilnehmern mitgearbeitet hat oder auch nur vage verfolgt, was für Kulturprojekte so ausgelobt und gefördert werden, wird an diesem Buch seine helle Freude haben. Denn es gibt so viele Momente zum Wiedererkennen in diesem Band, in dem eine nicht näher benannte deutsche Kulturorganisation (in meinem Kopf: das Goetheinstitut) auf die Idee kommt, eine Gruppe Schriftsteller aus verschiedenen Ländern mit dem Zug durch Europa tingeln zu lassen. Buchmessen und latent anstrengende Lesungen. Gruppendynamik und permanentes Wer-mit-wem-Getuschel. Deutsche Reiseleiter und halbverkrampfte Tanzabende. Zu überlegen, was an diesem Buch Fiktion ist und was Fakt, gehört zum Lesegenuss dazu. Auch, wenn man nicht genau weiß, ob man gerne mitgereist wäre oder dabei doch den Rappel bekommen hätte.
“The Imperfectionists” von Tom Rachman.
Eine doppelte Empfehlung, von gleich zwei Freundinnen, und völlig zu Recht. Es geht um eine kleine Zeitung in Italien, die auf Englisch erscheint – natürlich fällt es da schwer, im Kopf keine Parallelen zu meinem aktuellen Arbeitgeber zu ziehen. Die ganzen Journalistenmacken fand ich gut und glaubwürdig porträtiert, und die Mischung aus versäumten Chancen, fehlender Innovation und inkompetenter Geschäftsführung, die letztlich zur Schließung des Blattes führen, hat man so oder ähnlich auf dem deutschen Medienmarkt auch schon öfter erlebt. Nach dem Lesen ein kurzes Stoßgebet, dass die Moscow Times noch ein paar Jährchen vor sich hat.
“Georgisches Reisetagebuch” von Jonathan Littell.
Kein Buch bloß über, sondern direkt aus dem Georgien-Krieg im Jahr 2008. Der französisch-amerikanische Schriftsteller Jonathan Littell war damals auf beiden Seiten unterwegs und beschreibt hier nun die Strategien der zwei Konfliktparteien, ihren unterschiedlichen Umgang mit Journalisten und das tagtägliche Kleinklein aus Chaos, Taktieren und Feilschen in der Region. Ein kleiner Band, keine 60 Seiten, aber extrem nah dran und darum lesenswert.
“Journey to Karabakh” von Aka Morchiladze.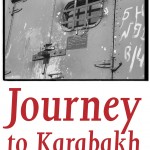
Geplant war ein Drogendeal, stattdessen geraten zwei Freunde nach Karabach und dort zwischen die Fronten. Die folgende Geschichte ist manchmal drastisch und oft überraschend leicht. Bemerkenswert auf jeden Fall, dass Gio, die Hauptfigur, als Gefangener im Krisengebiet freier in seinen Entscheidungen ist, als er es zuhause unter der Fuchtel seines Vaters war. (Vor diesem Buch noch mal ein paar Details zu Armenien, Aserbaidschan und Karabach nachzulesen, hilft.)
“Lingo” von Gaston Dorren.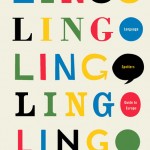
„A language spotter’s guide to Europe“ soll es sein, genau das richtige Buch für einen Sprachnerd also. In jedem Kapitel nimmt sich Dorren eine andere Sprache vor und zeigt eine ihrer Macken. Die vielen, nicht immer schmeichelhaften Versionen des Italienischen für „Frau“ (Donnina? Donnetta? Donnicina?). Das schiere Tempo, in dem Spanier ihre Silben raushauen. Nebenbei gelernt: Bis in die Sechzigerjahre hatten schwule Männer in England ihre eigene Geheimsprache namens
Polari. Norweger haben ein Wort für ein Bier, das man im Freien trinkt: Utepils. Und „Quark“ kommt tatsächlich vom Sorbischen „twarog“ – offenbar also ein direkter Verwandter des Russischen „tworog“. 2016 soll das Buch auf Russisch erscheinen.
“Jeeves in the Offing” von P.G. Wodehouse.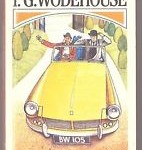
Der erste „Jeeves“-Band hat mich letztes Jahr ja nicht so mitgerissen, den hier fand ich schon viel besser. Was vermutlich weniger an den beiden Geschichten liegt als daran, dass man sich an diese Figuren, ihre Marotten und die Sprache, in der von ihnen erzählt wird, erst mal gewöhnen muss. Dann macht das Wiedererkennen tatsächlich Freude – erst recht als leichte kleine Urlaubslektüre, zu großen Teilen gelesen auf allerlei U-Bahn-Fahrten durch London.
“Die Reise nach Armenien” von Ossip Mandelstam.
Zu konfus, zu verwirrend, zu viel wildes Assoziieren: Bei manchen dieser kurzen Skizzen aus den 1930ern wusste ich am Ende immer noch nicht recht, worum es geht. Ja, das ist sicher alles originell formuliert und sprachlich liebevoll poliert – aber Lesefluss gibt es halt keinen. Also:
Mandelstam-Gedichte weiterhin jederzeit gerne. Mandelstam-Prosa lieber nicht noch einmal.
“Fathers and Sons” von Ivan Turgenev.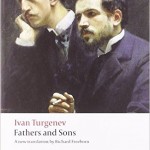
Hat ein bisschen gedauert, bis ich mit den Figuren warm geworden bin – und so richtig hat mich bis zum Schluss nicht berührt, was aus denen allen wird. Ja, der Generationenkonflikt steht für den Umbruch in Russland zu Turgenevs Zeiten, versteh ich alles, aber Bazarov – dieser grundzynische Nihilist, der alles in Frage stellt – hat mich wirklich lange genervt. Trotzdem liest sich das Buch gut, wegen Turgenevs Sprache und dem, was er mit seinen Charakteren so veranstaltet: Der Nihilist zum Beispiel darf nicht Nihilist bleiben, sondern ist zunehmend für die großen Gefühle zuständig, bei sich und bei anderen. Dazu ein paar typisch russische Orte und Themen – Birkenwäldchen, Landsitz, Duellanten. Sommerlektüre.
“The Penguin Book of Russian Poetry” von Robert Chandler, Boris Draalyuk und Irina Mashinski (Hrsg.).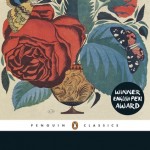
Eines der Bücher, an dem ich in diesem Jahr die meiste Freude hatte. Weil es so schön langsam ging – Gedichte kann man ja nicht einfach so runterlesen wie einen Krimi, oder ich kann es jedenfalls nicht. Also sind mit diesem Buch Erinnerungen verbunden an viele halbe Stündchen auf dem Balkon und ans
Abtippen, wenn etwas besonders griffig war. Zusätzlich zu den Gedichten gibt es gut geschriebene, pointierte Kurzbiografien der einzelnen Autoren. Was hängen bleibt von dieser geballten Ladung russische Dichtung, von diesem Band mit seinen über 500 Seiten: Eindrücke davon, was das Leben dieser Autoren geprägt hat, durch die Jahrhunderte, nämlich Orthodoxer Glaube, Natur, Familie, Liebe – und immer wieder politische Verfolgung.
“Letters to Georgian Friends” von Boris Pasternak.
Für Pasternak war, wenn man diese Briefe liest, Georgien zeitlebens das Gelobte Land. Weit weg von Moskaus Zwängen, in der Gesellschaft anderer Schriftsteller und ihrer Familien tankte er hier Kraft. Nachdem seine beiden engsten Freunde aus diesem Kreis bei Stalins „
Großer Säuberung“ ermordet werden, schreibt er vor allem immer wieder an Nina, die Witwe von Titian Tabidze. Lesenswert nicht nur wegen der Einblicke in Pasternaks Arbeitsalltag zwischen Gedichten, Übersetzerarbeit und später „Doktor Schiwago“, sondern auch dafür, mit welcher Hingabe er Freundschaften pflegt und feiert.
“Ein Monat auf dem Lande” von Iwan Turgenew.
Noch mal Turgenew, diesmal in der deutschen statt in der englischen Übersetzung. Und nein, das war keine bewusste Entscheidung, sondern nur der Tatsache geschuldet, dass die Moskauer Läden eher englische Versionen anbieten, dieses Buch hingegen in Deutschland gekauft ist, ganz stilecht als Reclamheft. Das Setting ist ähnlich wie bei „Fathers and Sons“ (Russland, obskurer Landadel, Sommer), aber dieses Stück hat mich beim Lesen mehr gefesselt. Dabei hat sicher geholfen, dass ich die ganze Zeit die Eindrücke aus London vor Augen hatte, aus der
rundum gelungenen Aufführung einer Patrick-Marber-Bearbeitung dieses Stoffes. „
Three Days in the Country“ statt ein ganzer Monat – das hat dem Stück gut getan und mir beim Lesen viele Bilder im Kopf beschert.
“Travelling to Work: Diaries 1988-1998” von Michael Palin.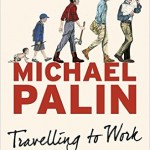
Drei Bände Palin-Tagebücher à rund 500 Seiten, gelesen innerhalb von anderthalb Jahren, von Monty Python über „Ein Fisch namens Wanda“ bis hin zu seinen Reise-Dokus. Weil der Mix aus Zeitgeschichte und Anekdoten, aus Entertainment-Industrie und Palins Handwerk als Autor, Moderator und Schauspieler sich einfach so gut liest. Wie sich dabei das Leichte, Lustige immer wieder mit dem Ernsten mischt, zeigt ein Tagebuch-Eintrag aus dem Jahr 1996: Als Palins Frau Helen ein Hirntumor entfernt wird, hat der Chirurg beim Nachsorgetermie eine Bitte: Ob er vielleicht mit Palin für ein Foto posieren könnte, als Gumby? Alle Hirnchirurgen seien schließlich große Gumby-Fans, wegen
dieses einen Python-Sketches.
Das Foto ist dann auch tatsächlich entstanden. Und sobald Palins vierter Band erscheint – das müssten dann die Jahre 1999-2009 sein – kommt er auch wieder auf die Leseliste.
“Heavy Water” von Martin Amis.
Eine Welt, in der die Mehrheit schwul ist (oder, mutmaßlich, lesbisch, aber es tauchen nur männliche Paare auf) und mit Befremden auf die paar Heten guckt, die da plötzlich für ihre Rechte einstehen. Eine Unterhaltungsindustrie, die total auf Gedichte abgeht, während ein Autor von SciFi-Filmen es zu nichts bringt. Ein Mann, der seine Frau hintergeht – „mit sich selbst“, wie es der Klappentext so taktvoll formuliert. Konstruiert, ja, aber es funktioniert. Nur mit der letzten Geschichte hab ich gekämpft, weil sie lautmalerisch zeigen will, dass da ein Kind spricht, dessen Akzent halb britisch und halb amerikanisch ist. „Jagob is dodally obzezzed by durdles, dordoizes, vrags, doads, labzders, grabs, and all zords of zlimy and weird-shabed rebdiles.“ Das hat sich dann doch mehr nach Gimmick als nach einem Kunstgriff angefühlt.
“Going Solo” von Roald Dahl.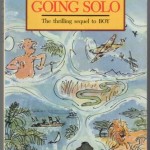
Ein Flohmarktfund. Den ersten Band von Dahls Autobiografie, „Boy“, hatte ich vor Jahren mal gelesen und gemocht. In diesem Buch erzählt er von seinem Leben als Shell-Mitarbeiter in Afrika in den 1930er Jahren, vom Ausbruch des Zweiten Weltkriegs und von seinen Einsätzen als Kampfpilot – alles mit diesem Roald-Dahl-Blick, der ihn auch zu so einem tollen Kinderbuchautor macht: Neugier, Staunen, Freude am Fabulieren. Gewundert hat mich nur, dass dieser Band als Buch für junge Leser vermarktet wird: bunt gezeichnetes Cover, „superb stories, daring deeds, fantastic adventures“ als Anreißer auf der Rückseite, erschienen bei Puffin, der Kindersparte von Penguin. Von Dahls detailliert beschriebenen Kriegsverletzungen bis hin zu dem, was er an Wissen über Frontverläufe, Hitlerdeutschland und das Vichy-Regime voraussetzt, ist das hier vielleicht was für Jugendliche, die sich für Geschichte interessieren. Aber sicher kein Kinderbuch.
“The Time Traveller's Guide to Medieval England” von Ian Mortimer.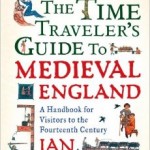
Eine Alltagsgeschichte des 14. Jahrhunderts, mit all dem, was sie einem als Journalist so einbimsen übers Reportageschreiben: Was sieht, hört, riecht man? Vieles schildert Mortimer so anschaulich, dass es bei mir auf Dauer hängengeblieben ist: Der Geruch von Abwasser, wenn ein Wanderer sich damals einer großen Stadt näherte – in Exeter hieß der Bach, in den all das geleitet wurde, ehrlicherweise gleich „Shitbrook“. Die Stille des Alltags, und wie sehr dadurch Musik zur Geltung kam. Bloß die Kapitel über Krankheit und mittelalterliche Chirurgie waren so anschaulich, dass ich einige Absätze überspringen musste.
“Prater Violet” von Christopher Isherwood.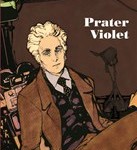
Reicht „ist halt von Christopher Isherwood“ als Begründung, warum auch das hier wieder ein großer Lesegenuss war? Der Autor Isherwood macht sich liebevoll über seinen Protagonisten Isherwood lustig und verbindet außerdem eine Geschichte über die Filmindustrie in den Dreißigern mit Hitlers dräuendem Aufstieg, der politischen Situation in Österreich und der britischen Haltung irgendwo zwischen „da muss man doch was machen“ und „was geht uns das an?“. Und all das mit diesen Isherwoodbeobachtungen: „The King’s Road was wet-black and deserted like the moon. It did not belong to the King or to any human being. The little houses had shut their doors against all strangers and were still, waiting for dawn, bad news and the milk.“
“Soviets” von Danzig Baldaev & Sergei Vasiliev.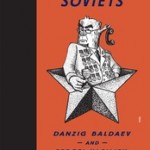
Karikaturen und Fotografien aus Sowjetzeiten, die Zeichnungen offen kritisch, die Bilder eher zeitgeschichtliche Dokumente. Zusammen sind das zwei interessante Blicke auf den Alltag in der UdSSR, auf Arbeit und Korruption, Kirche und Staat, auf Machthunger hier und sehr realen Hunger dort. Viele der Karikaturen sind mutig, andere legen einen krassen Antisemitismus an den Tag. Bei beiden war ich froh über die Fußnoten zum historischen Kontext.
“Hack Attack” von Nick Davies.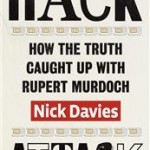
Einer der besten britischen Investigativjournalisten lässt sich in die Karten gucken: In „Hack Attack“ beschreibt
Nick Davies, wie er über Jahre hinweg nach und nach das Ausmaß aufgedeckt hat, in dem das Murdoch-Blatt „
News of the World“ die Telefone von Prominenten, Politikern, Opfern von Verbrechen und deren Angehörigen abhören ließ. Erschütternd ist daran vor allem, wie eng Polizei und Politik mit diesem Konzern verquickt waren und die Ermittlungen verschleppt oder behindert haben: Andy Coulson, zu dessen Zeit als Chefredakteur das Abhören gängige Praxis war, wurde später Pressesprecher des frisch gewählten Premierministers David Cameron. Was das Buch außerdem zeigt: Dass eine solch intensive Recherche nur selten aus spektakulären Undercover-Wallraffiaden besteht und sehr viel öfter aus Beharrlichkeit, Papierkram, Kontaktpflege und dem Bau von Allianzen. Und dass es nicht nur Journalisten braucht, die solche Themen recherchieren, sondern auch Chefredakteure wie Alan Rusbridger vom „Guardian“, die das Rückgrat haben, solche Geschichten zu veröffentlichen.
“Ёжик в тумане (Joschik w tumane)” von Juri Norstein.
Das Kinderbuch zum
berühmten sowjetischen Zeichentrickfilm über den kleinen Igel, der sich auf dem Weg zu seinem Freund, dem Bären, im Nebel verläuft. Eine gruselige Welt, in der er sich dort findet, aber dank der Ideen des Igels hat sie auch ihren Zauber: „Der Igel riss einen Grashalm aus, auf dem ein Glühwürmchen saß, und hielt ihn hoch über den Kopf, als wäre es eine Kerze.“ Weil Patenkind 2 das Buch zu Weihnachten bekommt, habe ich es gelesen und ins Deutsche übersetzt. Ein Erfolgserlebnis, und ein Stückchen mehr russische Alltagskenntnis.
“Malentendu à Moscou” von Simone de Beauvoir.
Ja, es klappt noch mit dem Lesen auf Französisch, wenn auch langsamer als früher. Die Geschichte: Ein Paar, beide gealtert und darüber unglücklich, reist in die Sowjetunion – die Konstellation
erinnert an Simone de Beauvoir und Jean-Paul Sartre. In Moskau haben sie ständig strammes Programm mit der Tochter des Mannes, und irgendwann sind beide genervt genug, dass sie aneinander geraten, spektakulär und dramatisch, wie man sich das bei einem französischen Paar so dem Klischee nach vorstellt. Die ganze Beziehung steht in Frage, aber dann liegen sie plötzlich wieder zweisam in einer Blumenwiese und lieben sich doch noch. Für mich hat sich das auf der Zielgeraden sehr hopplahopp angefühlt, dieser U-Turn Richtung Happy End. Der Weg dahin hat sich trotzdem gelohnt, vor allem, wenn diese wohlhabenden Pariser Bildungsbürger mit der Realität in der Sowjetunion konfrontiert sind, die sie als gesellschaftlichen Entwurf eigentlich unterstützen. Aber sie haben ja auch das Privileg der Touristen, wieder abreisen zu können.
“How to Build a Girl” von Caitlin Moran.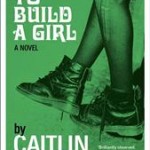
Stellenweise ein bisschen doppelig, wenn man Caitlin Morans Autobiografie/Feminismushandbuch „How to be a Woman“ kennt, denn auch bei diesem Roman bedient sie sich großzügig am eigenen Leben. Diesmal aber nicht mit dem abgeklärten, analytischen Blick einer etablierten Journalistin, sondern aus der Perspektive einer jungen Frau kurz vor der Volljährigkeit, die beschließt, sich komplett neu zu erfinden – und dabei leiderleiderleider die Idee verwirft, sich künftig „Belle Jar“ zu nennen. Egal, ob sie über das Leben am Existenzminimum schreibt, über die britische Musikszene oder über Sex („
Moran is in danger of becoming to female masturbation what Keats was to nightingales“), Moran ist so gut, dass wir einen kompletten Flug Moskau-Düsseldorf miteinander verbracht haben. (
Aeroflot-Bordessen unterstützt, gerade in Sanktionszeiten, die Atmosphäre von Armut und notgedrungen vitaminfreier Ernährung recht gut.)
“How Not to Become a Spy” von Justin Lifflander.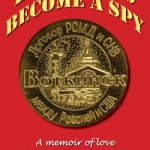
Ein paar Monate haben wir uns bei der Moscow Times überschnitten,
Justin Lifflander und ich, er hat dort das Wirtschaftsressort geleitet. Dass er sich in Russland gut auskennt, wusste ich – dass er bereits zu Sowjetzeiten aus den USA hierher kam mit dem Plan, Spion zu werden, hab ich erst aus dem Buch erfahren. Nach einem Job als Botschafts-Busfahrer war er später einer der Inspektoren, die kurz vor dem Ende der Sowjetunion den
IFN-Abrüstungsvertrag überwachten. Das klingt extrem seriös – nur dass Justin halt der Hausmeister und zeitweise auch Koch des Teams war, mit großem Talent zur Insubordination: Er baute im Keller der Unterkunft einen illegalen Whirlpool, versuchte sich als Kidnapper einer Ziege und verliebte sich in Sophia – die KGB-Frau, die ihn, den Überwacher, überwachen sollte.
In diesem NPR-Interview hier kann man ab 2’50“ hören, was Justin für ein Geschichtenerzähler ist. Sophia und er sind übrigens immer noch zusammen.
“Lenin Lives Next Door” von Jennifer Eremeeva.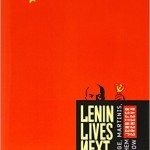
Das Buch meiner Moskauer
Mit-Bloggerin Jennifer habe ich gebraucht gekauft, und als es geliefert wurde, waren auf dem Schutzumschlag mehrere Ringe von abgestellten Gläsern. Passt gut zum Plot rund um (meist englischsprachige, meist wohlhabende) Expats, die in Russland Wurzeln geschlagen haben und sich das Leben nun mit Parties, Drinks und eisernem Zusammenhalt erträglich machen. Das Kapitel „The Red Handshake“ beschreibt, wie es ist, für ein russisches Unternehmen zu arbeiten – und ja, all die Vertrösterei, Verpeiltheit und allgemeine Unlust, Verantwortung zu übernehmen, hab ich aus dem Stand so wiedererkannt. Im vielleicht lustigsten, weil absurdesten Kapitel geht es um die russische Masche, Balkons rundum zu verglasen, damit man dort nicht an der frischen Luft sein muss, sondern drei Quadratmeter mehr Stellfläche für Gerümpel hat.
“Der Papyrus des Cäsar” von Jean-Yves Ferri und Didier Conrad.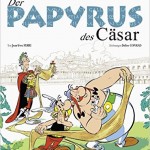
Es hätte mir ja schon völlig gereicht, wenn der neue Asterix (der erste, an dem weder René Goscinny noch Albert Uderzo mitgearbeitet haben) die Tradition nicht ramponiert. Dass er sogar richtig gut ist, mit Anspielungen auf Edward Snowden, staatliche Abhörpraktiken, Twitter und Kommunikation per Mail- bzw Brieftaubenanhang, ist um so schöner. Und das „Postskriptum“, ganz besonders das vorletzte Bild des Bandes – okay, keine Spoiler. Nur ein geseufztes „Hach“.
“Down There on a Visit” von Christopher Isherwood.
Das dritte Buch von „Mr Issyvoo“ dieses Jahr, wieder in einem Rutsch innerhalb weniger Tage durchgelesen. Dabei den rundum faszinierenden
Denham Fouts (im Buch „Paul) kennengelernt und bei vielen anderen Namen gerätselt, wer sie wohl in Wirklichkeit waren. Hugh Weston war leicht als WH Auden erkennbar, aber sonst? Und wer war wohl der G. aus dieser Anekdote: „Just back from a weekend in the country with G. A great mistake. Trailing all the way down to Kent just to make love in an inn gave the love-making an altogether false importance. We had to play up to it, pretend it was romantic, or at least fun. And it wasn’t. It was depressing, like the cold bedroom and the lumpy bed. Right in the midst of the act, I found myself grunting and groaning extra loud, out of sheer politeness. I dare say G., who is really very sweet, was doing the same thing. But I couldn’t discuss this. We don’t know each other well enough.“
“Sophia, der Tod und ich” von Thees Uhlmann.
Wenn der Tod an der Tür klingelt und du hast nur noch drei Minuten – was machst du damit? Die Frage stellt sich nur kurz, denn diesmal dauert alles ein bisschen länger: Der Tod, sein vorerst weiterhin untotes Opfer und dessen Ex-Freundin treiben sich noch ein bisschen auf der Erde rum. Dabei entwickelt der Tod eine große Lebensfreude und der (namenlose) Mann, den er holen soll, erlebt mit dem Gevatter und der Ex ein kleines Roadmovie. Ein Buch mit vielen Pointen und anderen schönen Stellen, immer wieder zum laut Vorlesen. Und der Hype, weil das eben das erste Buch von Thees Uhlmann ist, sorgt für genug Leute im Freundeskreis, die es auch gerade gelesen haben, um
gemeinsam unklare Stellen auszudeuteln.
“Hottentottenstottertrottel” von Wolf Schneider.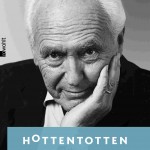
Wie Wolf Schneider als Kind kurzzeitig stotterte und sich dies dann mit Disziplin und Fleiß wieder abtrainierte – diese Anekdote, auf die sich der Titel bezieht, nimmt im Buch nur wenig Raum ein. Ein ziemlich offensichtliches „Schau mal, lieber Leser, auch ich hatte Schwächen, zumindest kurz“, denn ansonsten lässt Schneider vor allem die Leistungen seiner vielen Jahrzehnte als Journalist Paroli laufen. Das steht ihm zu, sicher, vor allem als Ausbilder und als Kämpfer für eine gute, klare Sprache hat Schneider viel geleistet. Aber dieser permanente Unterton von „da hab ich dem Nannen in der Konferenz aber mal als einziger Kontra gegeben“ und „da hab ich aber diesen linken Redakteuren mal gezeigt, wo der Hammer hängt“, von Seitenhieben Richtung Hartz-IV-Empfänger und Feminismus – Mann, Mann, Mann! Der Klappentext beschreibt Schneider als jemanden, „der schon politisch unkorrekt ist, bevor es den Begriff überhaupt gibt.“ Kann man so beschreiben. „Arroganz, Populismus und ein letztes Beharren, wer hier bitteschön immer noch die Deutungshoheit hat“ ginge aber auch.
“Granta 67: Women and children first”.
Die
Kaltmamsell liest immer
Granta, das reicht als Argument. Oder, doch etwas ausführlicher: Etwas lesen, worauf ich sonst nicht käme – das ist ein Reiz an sich. In diesem alten Band, gefunden beim Umzug unserer Redaktion, findet sich zum Beispiel ein Text von
Zadie Smith, ehe sie mit „White Teeth“ bekannt wurde. Einen anderen Beitrag konnte ich vor lauter grausamen Bildern im Kopf schließlich nur noch querlesen: „
The Problem Outside“ von
Linda Polman, einer Augenzeugin des Massakers von Kibeho in Ruanda.
“Slam” von Nick Hornby.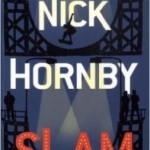
Meh. Der Plot und die Kunstgriffe (Zeitreisen, Dialoge mit einem Skater-Poster) haben mich überhaupt nicht überzeugt. Nach ein paar Seiten hat man begriffen, dass das düstere Ereignis, auf das alles zusteuert, die ungewollte Schwangerschaft eines Schüler-Paares ist. Und dann muss man da halt die nächsten mehr als 200 Seiten durch, mit Sam, dem 16 Jahre alten Vater des Kindes, der sich nach aller Kraft wie ein anständiger Mensch zu verhalten versucht. Und wartet auf eine Wendung, irgendwas, worauf das Buch noch hinsteuern könnte. Kommt aber nichts, nur Stress und Sorgen und Panik, und dann ist das Baby da, und Sam gibt seinem Leben 3 von 10 möglichen Punkten. Das Buch ist für „young adults“ gedacht, und die Botschaft an die ist offenbar tatsächlich:
Ein paar Sekunden Pech können Dein Leben zerstören, aber eventuell wird es Jahre später wieder ein ganz klein wenig besser.
“Die juristische Unschärfe einer Ehe” von Olga Grjasnowa.
Das zweite Buch von Olga Grjasnowa, nach „Der Russe ist einer, der Birken liebt“, und eigentlich wieder richtig gut. Zwei winzige Stadtproträts zum Beispiel: „die Auslagen der Geschäfte simulierten Reichtum als gesellschaftlichen Konsens“ (Baku). „Berlin war wunderbar – Homosexualität und Menschsein schlossen sich in europäischen Großstädten nicht mehr aus.“ Das einzige, was nervt, sind die vielen sprachlichen Fehler: „Servierten“ statt „Servietten“, „Liberal Art College“ statt „Liberal Arts College“, „Fouttés“ statt „Fouettés“. Dass mir sowas besonders auffällt, mag eine Berufskrankheit sein – aber spätestens bei „auf dem Wasser schwamm ein feiner Ölfilter“ liest es sich einfach nach Autokorrektur-Panne. Schade, weil es von einer interessanten Geschichte ablenkt.
“Fingerlickin' Fifteen” von Janet Evanovich.
Genau das richtige Buch für krank-auf-dem Sofa. Hohe Literatur sind die Krimis um Kopfgeldjägerin Stephanie Plum nicht, dafür aber so formelhaft, dass man auch mit rasselnden Bronchien und verschleimten Nebenhöhlen folgen kann. Stephanie hat nie Kugeln in ihrer Pistole, scheitert zunächst beim Versuch, eine ihrer Zielpersonen festzunehmen, steht permanent zwischen denselben zwei Männern, hat jeweils mit beiden dann doch ganz knapp keinen Sex, zerstört früher oder später zwei bis drei Autos und nimmt am Ende doch noch wen fest.
“Sizzling Sixteen” von Janet Evanovich.
Ganz schön hartnäckig, diese Erkältung, also ran an den nächsten Stephanie-Plum-Band. Plötzlich und unerwartet hat sie auch diesmal keine Kugeln in ihrer Pistole, scheitert zunächst beim Versuch, eine ihrer Zielpersonen festzunehmen, steht permanent zwischen denselben zwei Männern etc. Neu dabei ist eine Herde Hobbits. Alles leicht und lustig – kein Wunder, dass Evanovich aktuell mal wieder auf der
Bestsellerliste der New York Times steht, diesmal mit Nummer 22 der Plum-Krimis.
“Forty Stories” von Anton Chekhov.
Sein Grab auf dem Neujungfrauenfriedhof, eine seiner Kurzgeschichten im aktuellen Repertoire eines Moskauer Theaters, die Kladde mit seinem stilisierten Gesicht auf dem Schreibtisch einer Kollegin. Wie präsent Tschechow noch heute in Russland ist, war mir nicht klar, aber nach diesem Band verstehe ich, warum: Ob Prinzessin oder Waisenkind, ob ein sterbenskranker Bischof oder eine Katze, der in bester Pawlow-Manier abtrainiert wird, auch nur eine Maus zu jagen – über alle schreibt er so klug, authentisch und mitfühlend, dass man es ihm sofort abnimmt. „Angeblich teilen sich Leser in Russland in zwei Lager auf, Tolstojaner und Dostojewskijaner,“ sagt T., meine Russischlehrerin. „Aber wenn das die Auswahl ist, bin ich weder noch. Ich bin Tschechowianerin.“
“Nothing is true and everything is possible” von Peter Pomerantsev.
Eine Leseempfehlung für alle, die mehr über Russland wissen wollen als Putin-dies und Lawrow-das. Pomerantsev berichtet aus der Zeit, als er für einen russischen Fernsehsender arbeitete. Gewünscht waren Wohlfülgeschichten, aber er stieß immer auf Abgründe – Korruption, Sekten, Meinungsmache und Menschen, die sich mehr oder weniger geschickt verbiegen, um in dieses Russland zu passen. Da verzeiht man auch sein Faible dafür, Moskau alle paar Kapitel mit Gotham City zu vergleichen. (
Dem Guardian hat Pomerantsev erzählt, was sein Konzept beim Schreiben des Buches war.)
“Pushkin Hills” von Sergei Dovlatov.
Eine kleine
Episode aus Sowjetzeiten, in der ein nicht sehr erfolgreicher Schriftsteller sich als Reiseführer versucht und dabei eine unterhaltsame Bocklosigkeit an den Tag legt. Wenn er Details aus Puschkins Leben mal nicht weiß, wird halt geblufft. Leicht, lustig, lässig liest sich das, bis seine Frau ihm eröffnet, dass sie mit der gemeinsamen Tochter das Land verlassen will. Sein Durchwurschteln durchs Leben, ihre Suche nach grundsätzlichen Werten wie Freiheit – Zeitgeschichte.
“Von der Sowjetunion in die Unabhängigkeit” von Thomas Kunze und Thomas Vogel.Porträts von 15 Ländern, die früher Sowjetrepubliken waren – jeweils als politisch unterfütterter Reisebericht plus Steckbrief. Das klang interessant und übersichtlich, aber irgendwo zwischen „
Djen Pobeda“ (sic) und „Perestoika“ (sic), zwischen fehlerhaften Transliterationen aus dem Russischen und schiefen Bildern („die gelockerten Zügel ließen es gären“) fiel es mir zunehmend schwer, das ernst zu nehmen. Und da war mir noch gar nicht aufgefallen, dass auch ein Buch aus dem
Kopp-Verlag zitiert wird, war mir da noch gar nicht aufgefallen. Und das in einer Ausgabe der Bundeszentrale für Politische Bildung. Seltsam.
“My Discovery of America” von Vladimir Mayakovsky.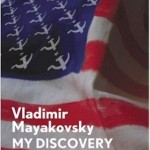
Gerade mal drei Jahre gab es die Sowjetunion, als Majakowski über Mexiko in die Vereinigten Staaten reiste. Es ging ihm vor allem darum, was man sich dort in Sachen Industrie und Elektrifizierung abgucken konnte. Leider hakt alles ein wenig, weil Majakowski so gut wie kein Englisch spricht und ihm immer wieder die Fakten durcheinander geraten (da retten die Fußnoten das Buch). Insgesamt nicht uninteressant, aber lange nicht so aufschlussreich wie „
Das eingeschossige Amerika“.
“Hyperbole and a Half” von Allie Brosh.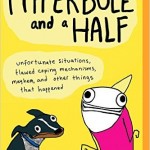
Ja, das ist das Buch zum
Blog. Ein paar Einträge kannte ich, aber das meiste war neu und genau richtig für die Zeit zwischen den Jahren: leicht, aber mit Tiefgang. Besonders gefallen hat mir, wie sie für ihre beiden bekloppten Hunde eine eigene Sprache (eigentlich eher eine eigene Syntax) erfindet. Das Kapitel „Dog’s Guide to Understanding Basic Concepts“ gibt es zwar nur im Buch, aber auch
in diesem Blogpost bekommt man einen guten Eindruck.
“Die heimlichen Revolutionäre - Wie die Generation Y unsere Welt verändert” von Klaus Hurrelmann und Erik Albrecht.
Warum kommt mir das nur so vertraut vor, was über die Generation eins unter meiner (hallo Y, hier winkt X) in diesem Buch steht? Es hat gedauert, bis der Groschen fiel: Weil das, was für die inzwischen allgemein gilt, uns werdenden Journalisten schon früher eingebimst wurde: Nicht damit planen, dass euch mal wer fest anstellt. Auf befristete Verträge einstellen, aufs Leben als Freiberufler. Darum liest sich das hier wie eine Mischung aus „über die“ und „über uns“ und damit doppelt interessant – auch wenn ich mir manches hätte etwas gestraffter gewünscht hätte.