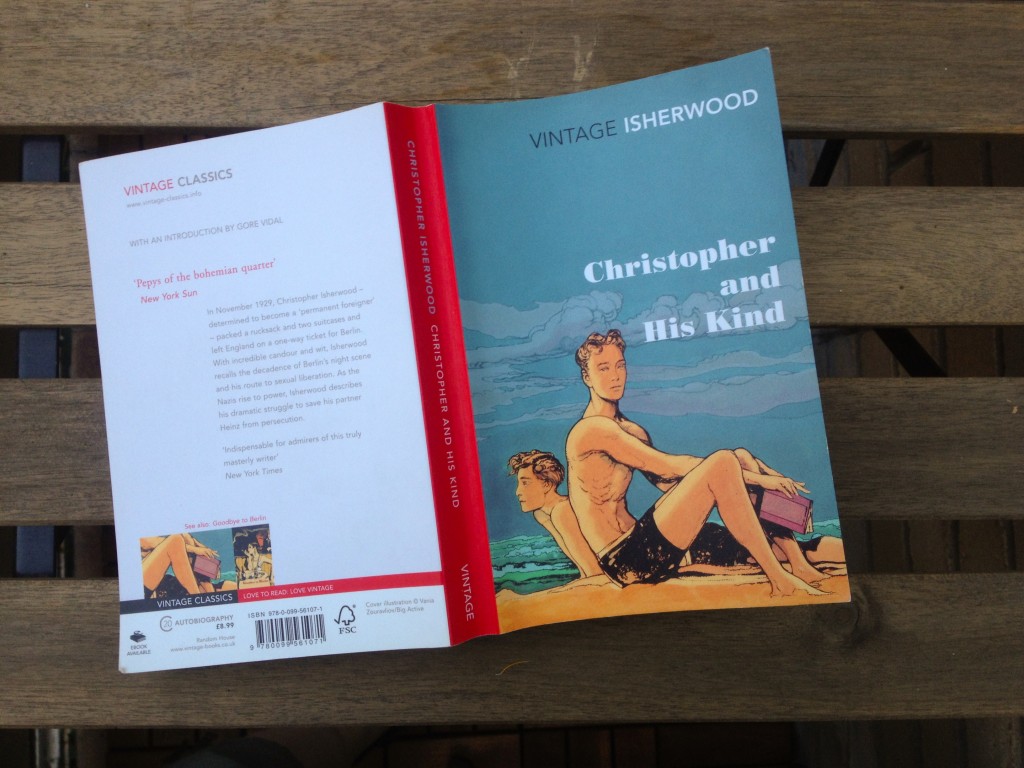Von Stephen Fry was Neues geht ja immer. Mit Hingabe guck ich schon lang QI (das hier hilft auch an grauen, trüben Tagen), les seine Bücher und retweete Tweets.
„The Ode Less Travelled“ kannte ich noch nicht, dabei ist es schon länger auf dem Markt. Es geht, ganz grob, um Dichtung. Um das Werkzeug, das jeder hat, wenn er mit Sprache spielt. Wobei Herr Fry am Anfang erst mal streng ist und seinen Leser schwören lässt: Dass der sich Zeit nimmt für das Buch, dass er die Verse darin, wenn möglich, laut vor sich hin liest. Beim dritten Punkt hab ich etwas gepfuscht: Man soll, schreibt Stephen Fry, stets ein Notizbuch mitnehmen, ganz egal, wohin man geht. Das war mir in der Metro doch zu lästig, geschrieben hab ich also nur daheim.
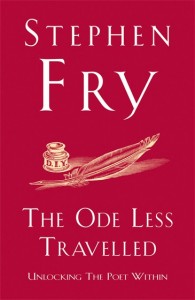 Fry legt schnell los, zitiert sich durch Gedichte, schreibt eigene, die oft recht schmutzig sind. Dann, alle paar Kapitel, eine Übung, bei der der Leser selbst zum Autor wird: Im jambischen Pentameter zu schreiben braucht gar nicht so viel Übung, bis es fluppt.
Fry legt schnell los, zitiert sich durch Gedichte, schreibt eigene, die oft recht schmutzig sind. Dann, alle paar Kapitel, eine Übung, bei der der Leser selbst zum Autor wird: Im jambischen Pentameter zu schreiben braucht gar nicht so viel Übung, bis es fluppt.
Natürlich hilft es dabei, dass auf Englisch für vieles eine Silbe reicht, das heißt: Von birth und death bis hin zu sun und moon ist alles kurz und dadurch passgenau. Das Buch vertreibt auch zügig so Ideen wie die, dass sich am Schluss was reimen muss. (Reim-Übungen gibt’s trotzdem, was ein bisschen mehr Arbeit für Nicht-Muttersprachler macht.)
Nach ein paar Tagen steht das Ritual: dieselbe Kladde und derselbe Stift, das Datum oben in die Ecke – los! Nichts davon taugt, um es hier zu zitieren – aber der Stolz auf die paar Zeilen wärmt. Schnell fließt mit jedem Mal das Englisch besser, der Versfuß hinkt und stolpert auch nicht mehr. Kein Herz auf Schmerz, stattdessen neue Formen: ein Cento, ein Haiku, dann ein Rubai.
Was bleibt nach diesem Buch? Die volle Kladde mit Übungen in Bleistift – und ein Puls. Der jambische Pentameter sitzt so, dass selbst das Bloggen seinen Regeln folgt. Wer das nicht glaubt, klickt hier für den Beweis.