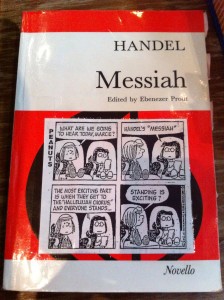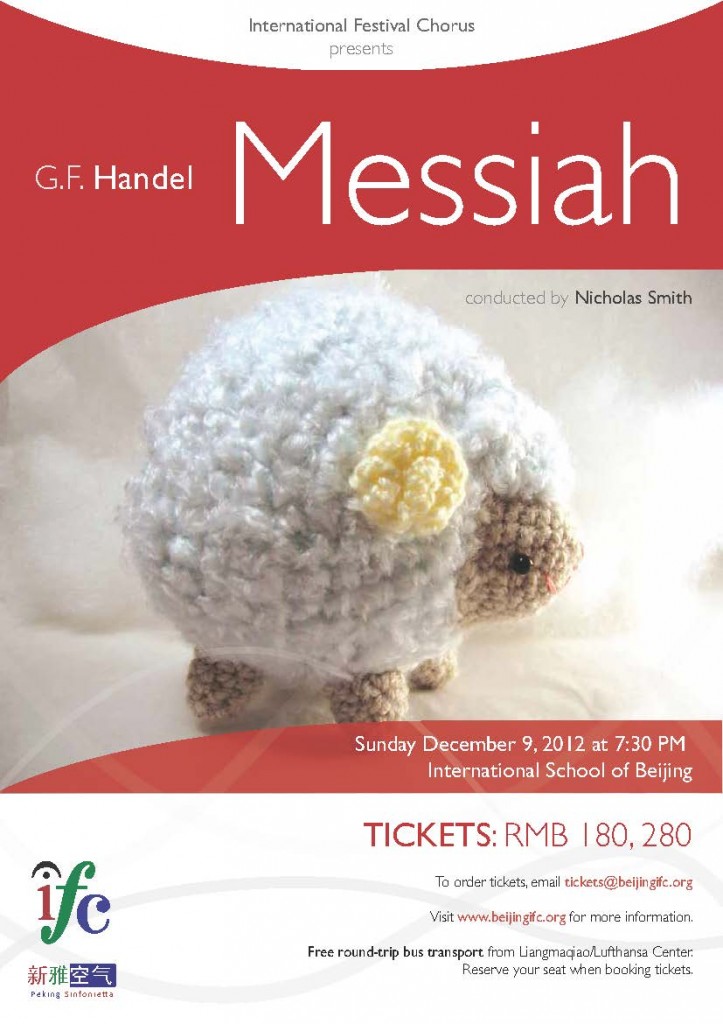Die „Trauer“ und den „Marsch“ haben sich die Russen aus dem Deutschen entlehnt. „Траурный марш“ [traurni marsch] heißt also einer der vielen Facebook-Termine, der am Samstag Morgen die Runde macht: Zum Gedenken an Boris Nemzow, der am Abend vorher erschossen worden ist, werden sich später Zehntausende Menschen treffen – während ich am Rechner sitze, arbeite und über Trauer nachdenke. Über die große, sichtbare um Nemzow, und über die sehr viel weniger öffentliche in den Tagen zuvor.
Anfang der Woche ist Sascha gestorben, unser Pianist beim Moscow International Choir. Tot umgefallen, keiner weiß warum. Eine bedrückende Probe, ein wenig Rat von russischen Freundinnen (Blumen in gerader Zahl, Kopftuch), und dann ist es Freitag und wir stehen in der Auferstehungskirche, zwei Fußminuten von der St. Andrew’s Church, in der Sascha den Chor durch unzählige Abende begleitet hat, beim Üben und im Konzert. Und nicht nur uns, auch andere Ensembles, außerdem hatte er seine Schüler am Konservatorium. Viele junge Gesichter also hier im Gottesdienst. Sascha selbst war noch keine 30.
Fast 200 Menschen stehen um den offenen Sarg; in russischen Kirchen gibt es keine Bankreihen, wie wir sie kennen – höchstens am Rand ein, zwei Sitzgelegenheiten für alte Menschen. Die Gemeinde singt auch nicht, stattdessen wechseln sich der Priester und ein Chor ab. Im Alltag sind das oft gerade mal drei Sänger, heute aber ein ganzes Dutzend. Profimusiker aus seinem Freundeskreis, in eine Ecke gequetscht, die erkennbar für deutlich weniger Leute gedacht ist. Zwischen ihren ersten Tönen und den letzten, zu denen sie später singend den Sarg aus der Kirche tragen, bin ich vor allem eines: überwältigt.
Nicht, weil ich nicht gewusst hätte, wie wichtig Inszenierung und Mystik in der orthodoxen Kirche sind – die Wände voll dunkler Ikonenmalerei, das Gold überall, das Kerzenlicht, die dicken Weihrauchschwaden, immer wieder. Aber jetzt, wo die russischen Chormitglieder uns „Internationals“ dezent und wortlos durch den Gottesdienst dirigieren, hier noch ein Kopftuch leihen, da ein kleines Blatt Papier anreichen, damit einem die Kerze nicht auf die Hand tropft; jetzt, wo diese urtümlichen Harmonien durch den Raum klingen, wo so viele Blumen auf dem Sarg liegen, dass sie herabzurutschen drohen, jetzt, wo wir nicht nur gegen die Kälte die Arme um uns verschränken – jetzt frage mich, ob das alles wohl hilft.
Der Familie, vor allem den Eltern, die hier nun seit fast zwei Stunden ihren toten Sohn ansehen müssen. Den Freunden, die noch mehr mit ihm verband als ein, zwei mal die Woche gemeinsame Musik – und die nun nach und nach zum Sarg gehen, Sascha auf die Stirn küssen und sich bekreuzigen. So offen sichtbare Trauer, ein so lang hingezogener Abschied, vor den Augen der anderen, ohne Rückzugsraum. Spendet das Trost, wenn es das ist, was man kennt und wo man hineingewachsen ist?
Ein paar Tage später kommt die Frage wieder hoch. Eine Woche ist es her, dass wir von Saschas Tod erfahren haben. Heute war es ein anderer offener Sarg, an dem eine andere Mutter stand – Dina Eidman, die sich mit 88 Jahren von ihrem Sohn, Boris Nemzow, verabschiedete.
Von der Redaktion fahre ich direkt zur Probe, natürlich reden wir über Sascha – seine Konzertreisen, noch vor kurzem, seine Geduld mit uns Amateuren. Zu meinem Ausländer-Blick auf die Trauerfeier sagt eine russische Freundin mit viel Europa-Erfahrung: „Ich weiß, anderswo ist vieles verdeckter, dezenter. Für mich fühlt sich das an wie Verdrängung, als wollte man alles schnell hinter sich bringen. Wir trauern wie die Italiener – intensiv und offen.“
Den Flügel hat jemand vor den Altar geschoben. Wo sonst Sascha saß, steht heute ein aufgeschnittener Wasserkanister mit weißen Blumen.