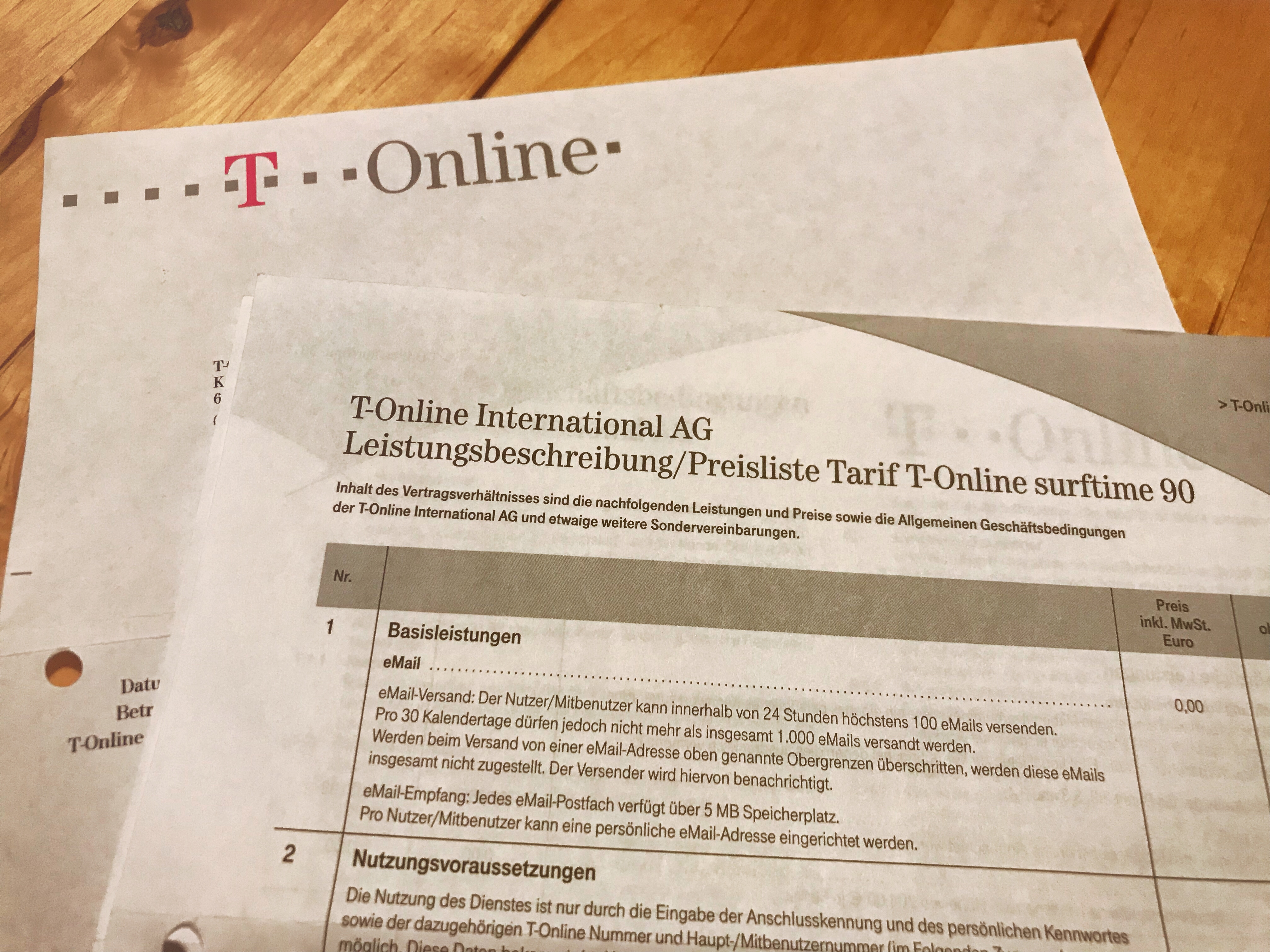Dieses Jahr sind zur re:publica mehrere Freunde gekommen, für die es das erste Mal dort war. Interessant, von ihnen zu hören, was die Konferenz für sie war oder nicht war: „Guter Ort zum Leutetreffen, aber nichts, wo ich was Konkretes für meine Arbeit mitgenommen habe.“ – „Eine Veranstaltung, wo man sich wünscht, an den Sessions stünde dran ‚für Anfänger‘ oder ‚für Fortgeschrittene'“ – „Endlich sind mal mehr Leute aus unserem Unternehmen hier, damit sich das Wissen von hier auch mal verteilt.“
Ein Anlass, darüber nachzudenken, was die #rp19 für mich war. Dabei ist mir vor allem etwas aufgefallen, was sie nicht war. Zum Beispiel keine Konferenz, bei der man sich erst ins WLAN einwählen müsste – das klappt automatisch noch vom letzten Mal. Sicherlich auch nicht das letzte Mal, dass ich mir etwas anschaue, das Jo Schück moderiert – wie der die Diskussion zwischen Axel Voss und Markus Beckedahl geleitet hat, Respekt.
Vor allem aber ist auffällig, was die re:publica in diesem Jahr nicht war, früher aber schon. Kein Thema mehr, um das die Tagesschau in ihrer Hauptausgabe rumkommt. Kein kleines, kuscheliges Treffen in der Nerdnische. Und, zumindest für mich, auch nicht mehr der Ort, wo man hinfährt, um sich einmal im Jahr rückzuversichern und dann wieder in eine Welt zurückzukehren, wo man als Onliner die leicht seltsame Randfigur ist. Dazu eine kleine Anekdote.
Es ist ein früheres Jahrzehnt und ich bin eine von zwei CvDs in der Onlineredaktion eines großen Zeitungsverlags. So, wie Kinder dazu da sind, ihren Eltern den Computer einzurichten, sind wir (neben dem dafür deutlich qualifizierteren Helpdesk) für alles zuständig, was irgendwie mit Technik zu tun hat. Bisschen seltsam, andererseits freut man sich im Sinne von Kontaktpflege und Kulturwandel ja über jeden Kollegen, der auf einen zukommt. Und wer weiß, vielleicht ist Führungskraft X ja demnächst auch mal bereit, einen Text online zu stellen – jetzt, wo wir ihr gezeigt haben, wie das auf dem Handy mit den Umlauten geht und sie endlich ihren Nachnamen richtig unter ihre Mails schreiben kann.
Eines Nachmittags klingelt eines der Telefone am Desk, jemand wird zu mir durchgestellt, wir stellen uns vor. Es handelt sich um Wichtige Person X – wir kannten uns bisher nicht, dafür ist sie eng verbunden mit Wichtiger Person Y, die man fände, wenn man mit dem Finger auf einem Organigramm von meinem CvD-Posten bis fast ganz nach oben fährt. WP X geht es um ein Wohltätigkeitsprojekt; irgendwas soll zugunsten irgendeines Zweckes verkauft werden, das Geld dann gespendet. Wir reden ein wenig, und je mehr wir reden, desto klarer wird: WP X möchte, dass wir, die Online-Redaktion, dazu eBay nachbauen. Schließlich gibt es etwas zu versteigern, und er hat gehört, dass andere Firmen dafür Plattformen gebaut haben, und wir sind ja nun ein großes Verlagshaus, also ja wohl ausreichend aufgestellt, sowas auch zu bauen, für diese eine Auktion.
Ich versuche, das Ringen um Fassung hintenan zu stellen zugunsten des Aufzeigens von Alternativen. Wir könnten eine bestehende Plattform nutzen. Wir könnten Leuten anbieten, ihre Gebote zu mailen. Wir könnten eine Live-Auktion veranstalten und im Print und online dazu einladen. Ehrlich gesagt weiß ich nicht mehr, was ich alles angeboten habe, aber WP X wird zunehmend ungehalten und verlangt schließlich, mit der Chefin verbunden zu werden.
Nach ein paar Minuten stellt die Chefin WP X wieder zurück zu mir. Ihre Aussage war wie meine, aber mit Chefinnensiegel. Und tatsächlich hat WP X immerhin die Größe, sich zu entschuldigen. Nein, nicht etwa mit den Worten „Da hatten Sie wohl recht“ oder, gesichtswahrend, „Da haben wir wohl aneinander vorbei geredet.“ WP X sagt zu mir am Telefon: „Tut mir leid, Frau Scheib – ich wusste nicht, dass Sie auch einen Dienstgrad haben.“
Solche Geschichten waren es, die wir uns bei der re:publica erzählt haben, als sie noch kleiner und quasi eine dreitägige Therapiesitzung für Onliner in Offlinehäusern war, für mich, und für zig andere in derselben Situation. „Wie hast du das bei dir gelöst“ – „Wen hast du dir als Verbündeten gesucht“ – „Wie hast du erklärt, warum…“ – „Welche Zahlen hast du ihnen gezeigt, damit…“ Rückversicherung und Reality Check.
Vielleicht hat mir die Lesung des Techniktagebuchs das vor Augen gefühlt: Was damals™ wichtig, ernst oder unumgänglich war. ist heute oft vor allem lustig. Wenn ich heute die Verbündeten von damals sehe, wenn wir zusammen in Sessions zu Emojis oder Podcasts oder Presserecht sitzen – dann muss ich daran denken, wie froh ich bin, dass die re:publica heute nicht mehr der Ort ist, wo man sich dringend nötige moralische Unterstützung in ganz grundlegenden Onlinefragen holt.
Kann gut sein, dass andere Leute aus anderen Konstellationen immer noch solche Gespräche führen, sich bei der Konferenz immer noch den Rückhalt von Mitkämpfern holen. Aber wenn ich mir anschaue, wie sich die re:publica in Sachen Relevanz und Akzeptanz weiterentwickelt hat, dann gönne ich mir manchmal den Optimismus, zu glauben, dass wir in den vergangenen Jahren doch ein bisschen vorangekommen sind mit diesem Onlinedings.