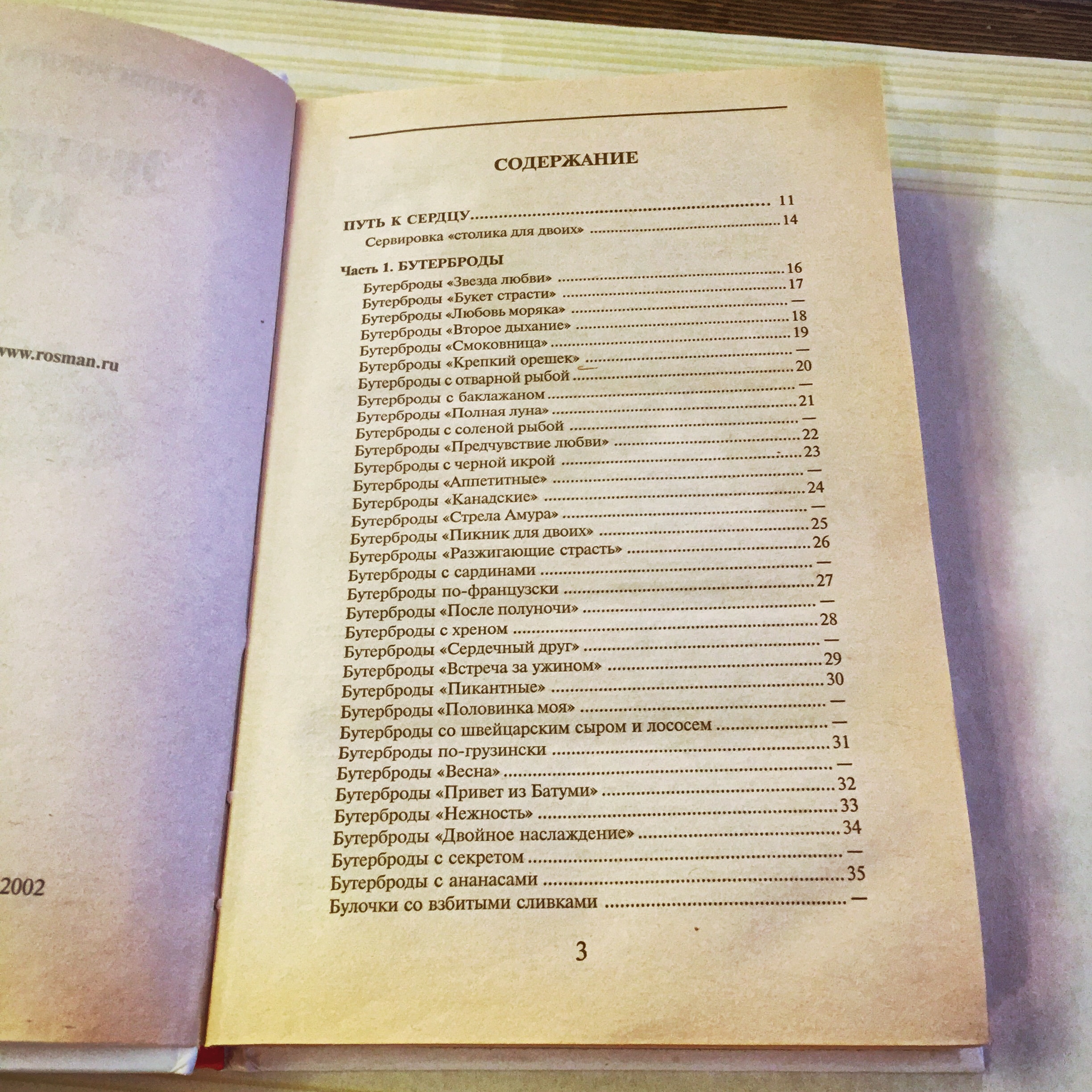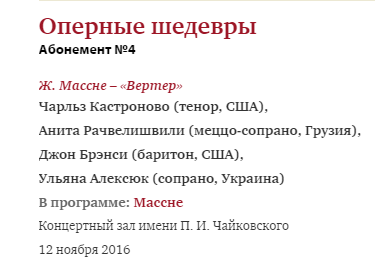Nach einer Woche, die beruflich unnötig ärgerlich war und vor einer Woche, die den ersten Schnee bringen soll, hilft es, wenn das Wochenende es einem mal so richtig zeigt. Was es heißen kann, in dieser Stadt zu leben und Wurzeln geschlagen zu haben. Wie es ist, wenn man Leute gefunden hat, für die „warum nicht“ Grund genug ist, etwas auszuprobieren. Wo man sich plötzlich wiederfindet, wenn man sich Moskau einfach mal ausliefert – und am Montagmorgen immer noch davon zehrt.
***
Samstag, früher Nachmittag. Wenn man das Puschkinmuseum, die alte und die neue Tretjakowgalerie, das Garage-Museum für moderne Kunst, das Multimedia Art Museum, das Moscow Museum of Modern Art, das jüdische Museum, das Museum für sowjetische Spielautomaten, das Kosmonautenmuseum, das Darwinmuseum, das Museum des Russischen Impressionismus, das Zentralmuseum des Großen Vaterländischen Krieges, das Zentralmuseum der russischen Streitkräfte, das Oldtimermuseum, das Borodino-Museum, das Museum für Orientalische Kunst, das Zoologische Museum, das Geologische Museum und das Architekturmuseum durch hat – dann, ja dann findet man sich plötzlich im Moskauer Museum für Straßenbeleuchtung wieder.
Also stehen G. und ich nun in einem von vier Kellerräumen und bekommen erzählt, dass damals zur Krönung von Alexander II. in Moskaus Straßen eine Festbeleuchtung aus 27.000 Öllampen in grünen Glaszylindern strahlte. Wie nach Öl und Kerosin erst Gas und dann Elektizität kamen (mit Osram-Glühbirnen aus Deutschland, das Museum zeigt dazu einen Werbespot aus dem Sechzigerjahre-Deutschland, in dem Osram-Glühbirnen Verkehrsunfälle und Raubüberfälle verhinden).
Wir sehen Verdunkelungsschilder aus dem Zweiten Weltkrieg („Licht im Fenster hilft dem Feind“), Stehlampen, Hängelampen und eine der 5000-Watt-Leuchten, die in den roten Sternen auf den Spitzen der Kremltürme stecken. Das Museum ist, soviel merkt man sofort, seinen Machern eine Herzensangelegenheit.
Sie erklären die Pulte, von denen aus einst Stadtteil für Stadtteil Moskaus Lichter angeknipst wurden, und zeigen eine Vitrine mit Birnen, in denen statt Drähten kleine Kunstwerke glühen: Blumen, Tiere, ein Schneemann. „Woher haben Sie denn von unserem Museum erfahren?“, fragt die Kassenfrau leicht perplex uns zwei erkennbare Ausländerinnen. Und überhaupt, wenn uns Straßenbeleuchtung interessiert: Im Sommer bietet das Museum auch Stadtrundgänge zum Thema an.
***
Um den Tisch sitzen acht Leute aus fünf Ländern und reden Englisch, jedenfalls meistens. Nicht alle kennen sich, aber alle kämpfen mit derselben Speisekarte auf Koreanisch und Russisch, wechseln durch ihre jeweiligen Sprachen und die dazugehörigen Übersetzungs-Apps: Okay, Reis, Möhren, Zucchini – und was ist da noch drin? Kennst du das Wort? Sag’s noch mal langsam in deiner Sprache, vielleicht erkenn ich’s ja wieder? Wir entschlüsseln Fleisch- und Gemüsesorten, ehe wir irgendwo zwischen „Alge“ und „Farn“ kapitulieren. Passt schon. Mal sehen, was kommt.
Der Ort ist unterirdisch und es ist schwer, darin keine Metapher zu sehen, denn wir sind in Moskaus einzigem nordkoreanischen Restaurant. Es geht das Gerücht, dass es zur Botschaft gehört und dazu dient, mit Einnahmen in ausländischen Währungen das System zu stabilisieren. Ob der Rubel dabei eine große Hilfe ist? Alle Kellnerinnen sehen gleich aus – gleichgroß, gleichjung, gleichschön, gleichlange Haare, gleiche Frisur, gleiche Kleidung, gleiche Plateausohlen. Auf einem Fernseher läuft in Dauerschleife ein Konzert der Band Moranbong, im Publikum synchron applaudierende Militärs.
Dass das Essen auf keinen Fall in der Reihenfolge eintrifft, in der man es bestellt – wer würde es in Russland anders erwarten. So essen sechs von uns also in Etappen ihr scharfes Bibimbab (oder, wie die Speisekarte es erklärt, „Plow nach Pjönjanger Art“), danach kommen die Vorspeisen, darunter eine Art Pfannkuchen aus Maiskörnern, zusammengehalten von irgendwas zwischen Aspik und Fugensilikon. Und zum Schluss die Nudelsuppe für die zwei verbleibenden Hungrigen, am Tisch angerichtet. Die Kellnerin gibt gekochte Nudeln in zwei große Metallschalen, dann Fleisch und Gemüse, dann Wasser aus einem silbernen Teekessel mit schmaler Tülle. Die Kellnerin verschwindet, die beiden Nudelsuppenbesteller fangen an zu essen: Die Suppe ist kalt. Nicht abgekühlt, sondern nie warm gewesen. Gehört wohl so. Kurz darauf trifft eine weitere Vorspeise ein.
***
Sonntag Nachmittag und ich weiß nichts, außer dass M. mich heute zum Segeln mitnimmt. Fünf Jahre lang hat er in einem anderen Land „reichen weißen Kindern“ das Segeln beigebracht. Meine Segelerfahrung beschränkt sich auf die kälteste Woche meines Lebens, damals, kurz vor Ostern, auf einem Schiff auf dem Ijsselmeer. Nach Anweisung von M. bin ich heute 1. extrem warm angezogen und 2. pünktlich an unserem Treffpunkt, einer Hofeinfahrt im Moskauer Zentrum, in der ein knatschblauer alter UAZ-Geländewagen steht. „Wir haben beschlossen, dass du vorne sitzt – da gibt es einen Sicherheitsgurt“, sagt der Fahrer und Mitsegler, der mir kurz nach dem Start erklären wird, warum er trotz allem weiterhin Trump wählt.
Das Gespräch in eine andere Richtung zu lenken bedeutet, dass ich in der nächsten Stunde sehr viel über den UAZ erfahre. Dass man mit dem Hebel da zwischen Zweirad- und Allradantrieb wechseln kann. Dass es viel Kraft kostet, zu schalten und zu lenken. Dass außerhalb der Stadt plötzlich andere Fahrer winken und lichthupen, wenn man in so einem alten Schätzchen unterwegs ist. Dass das Auto zwar viel ächzt und andere Geräusche macht, die aber alle nichts bedeuten. Auf dem Rücksitz spielt K, eine junge Russin und Nummer vier unserer heutigen Segelei, mit ihrem Handy.
Als wir am Ziel nördlich von Moskau ankommen, noch weiter außerhalb der Stadt als Ikea und Obi, muss es flott gehen. Die Sonne steht schon tief, der Wind ist so stark, dass er uns immer wieder zurück Richtung Anlegestelle drückt und uns schließlich ein kleines Motorboot rausschleppt. Skipper M. geht das erkennbar an die Ehre, weshalb wir danach erst mal betont souverän in den Sonnenuntergang schippern. Es ist, das sagen auch die Mitsegler, schon verdammt windig heute – viele Kommandos, schnelles Wechseln von einer Seite des Boots zur anderen und zurück. Ich denke mir: Solange K. noch Handyfotos auf Instagram postet, wird es schon so ernst nicht sein. Und es mangelt ja auch nicht an Motiven: Das Wasser, in dem sich die Sonne spiegelt. Der Himmel, ganz frei vom Moskauer Herbstsmog. Die Birken am Ufer, in Gelb und Orange.
Auf dem Rückweg Richtung Ufer wird es dann noch mal ein wenig unentspannt. K. hat das Handy weggepackt und sieht käsig aus, M. holt sich bei einem Manöver nasse Füße, und wir alle lehnen uns zur selben Seite raus, so weit wir nur können. Dafür ist das Anlegemanöver dann perfekt, Ehre wiederhergestellt. In der Abenddämmerung fährt der UAZ zurück Richtung Zentrum, aus dem Bluetooth-Lautsprecher kommen abwechselnd Abba und amerikanische Powerballaden. Waterloo. Carry on My Wayward Son. Does Your Mother Know. K. sitzt jetzt vorne, M. und ich haben auf der Rückbank russische Militärhelme aufgesetzt. Safety first. Durch die Dachplane zieht Kälte ins Auto, aber immer noch wärmer als auf dem Wasser vorhin. „Nächstes Wochenende gehen wir auf den Schießstand,“ sagt K. „Komm doch mit.“