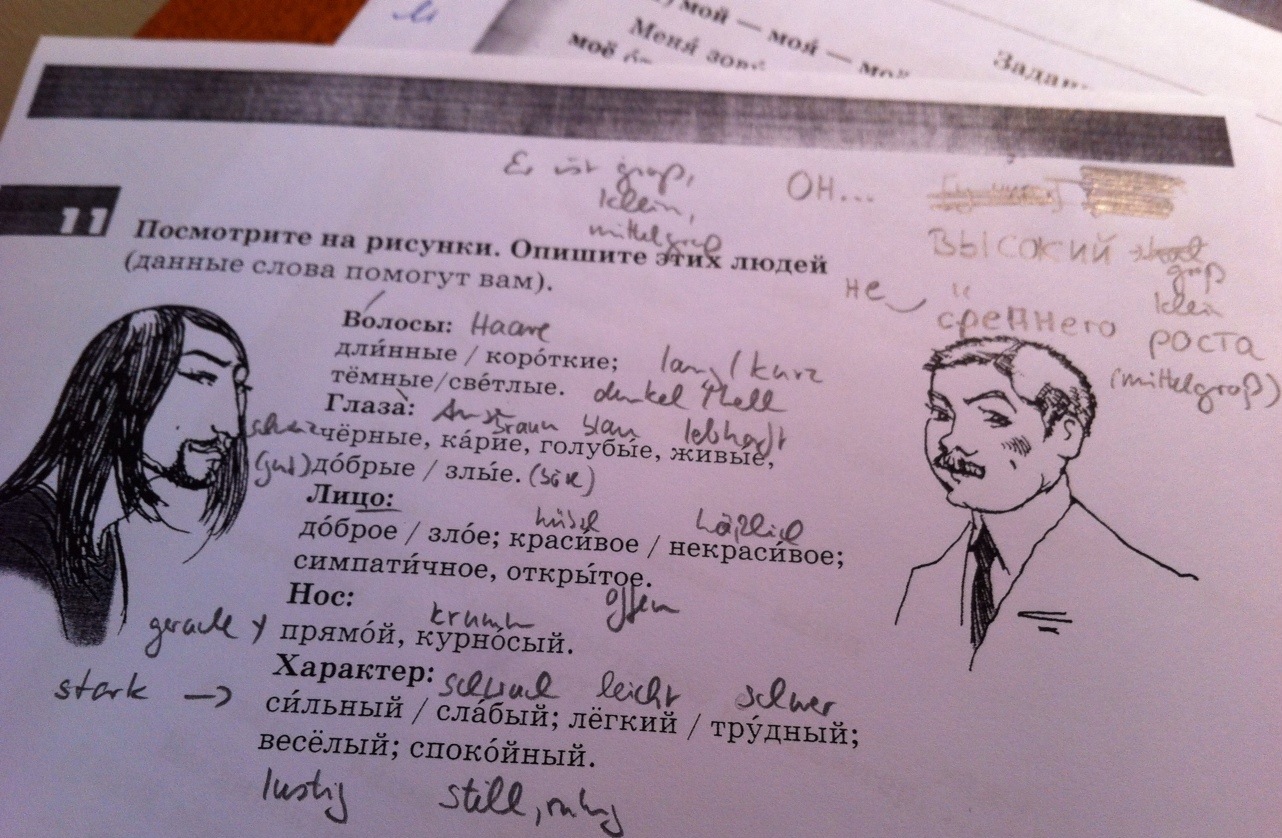- Nachricht, Reportage, Interview, Feature, Glosse, Kommentar. Diese geläufigen journalistischen Formate haben Gesellschaft bekommen. Vor allem online begegnen einem immer mehr Texte nach dem Prinzip „Fünf Dinge, die Sie über den Kanal-TÜV wissen müssen“, „Zehn Knackpunkte bei den Koalitionsverhandlungen“ oder „Elf Karnevalskostüme zum Selbernähen.“
- Die Form selbst ist nicht neu (zehn Gebote, 95 Thesen) und auch kein Online-Phänomen, sondern von Frauenzeitschrift (die sieben besten Kürbisrezepte) bis Autoheft (zehn Tipps zum Spritsparen) verbreitet. Aber dadurch, dass online die Längen- und Gestaltungsvorgaben weniger strikt sind als im Print, blühen solche Texte dort besonders.
- Kaum jemand ist da so weit vorne wie Buzzfeed. Dort gibt es auf der Startseite kaum Überschriften, in denen keine Zahl vorkommt.
- Häufig benutzte Zahlen bei diesem Format: drei, fünf, sieben, zehn, zwölf, zwanzig, hundert.
- Eher selten: vier, sechs, achtundzwanzig.
- Extrem selten: eins.
- Auch wir bei DerWesten beteiligen uns daran, zum Beispiel mit den „Zehn Irrtümern über…„. Und der Guardian ist natürlich längst auf der Meta-Ebene angekommen.
- Der Name für diese Art von Text ist „listicle“, entstanden aus den englischen Wörtern „list“ und „article“.
- Er ließe sich also auch problemlos zu „Listikel“ eindeutschen.
- Ihr habt gerade einen gelesen.
(Eine gar nicht mal so unähnliche Variante dieses Texts ist in der Wochenendbeilage der WAZ erschienen.)