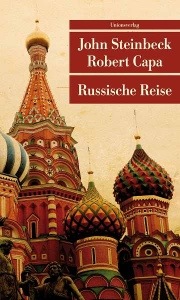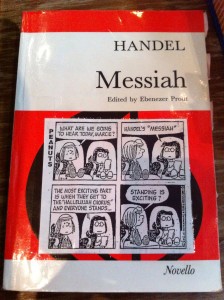Dieses Jahr habe ich in keinem Weihnachtskonzert gesungen – weiß nicht, wann das zuletzt so war. Vielleicht zu Unichorzeiten, wo die Konzerte eher während des Semesters lagen? Sonst aber kenne ich es nicht anders: Wenn andere die letzten Grillparties und Radtouren des Jahres machen, befassen wir Chorsänger uns mit Jauchzet-frohlocket-venite-adoremus-gnadenbringende-jingle-all-the-way-il-est-né-le-tusen-juleljus-i-mnogo-mnogo-radosti.
Diesmal war das anders, und spätestens da habe ich gemerkt, wie sehr mir das dieses Jahr gefehlt hat. Einmal die Woche zusammen runterkommen, ausatmen, einatmen, konzentrieren und Musik machen. Einen Chor finden, das habe ich in so gut wie jeder neuen Stadt stets direkt erledigt, und auch in Berlin habe ich es versucht, aber es war verkorkst. Nicht nur, weil ich zum ersten Mal nicht mehr in einem Alter bin, wo man es bei Chören namens „Junge Stimmen/Klänge/Sänger“ versucht. Oder auch weil ich nach fünf Jahren lustig, laut und legato im Moscow International Choir unsicher war, was ich eigentlich noch kann, so an differenzierterem, komplexerem Musizieren. Irgendwas ist immer dazwischengekommen.
***
Anfang des Jahres will die Neue Philharmonie Carmina Burana aufführen, da braucht man gut über 100 Sänger. Wir bewerben uns gemeinsam, S. und ich, nachdem wir schon in Moskau mehrere Jahre lang zusammen Musik gemacht haben. Die Proben sind super – der Chorleiter verlangt viel, justiert permanent nach und hat erkennbar Spaß an den anzüglichen Texten. Und schau, er hat einen Chor – da könnten wir doch über Carmina hinaus mitsingen! Doch leiderleider: Proben zweimal die Woche, dazu Konzertreisen, das schaffen weder S. noch ich. Immerhin bleibt uns, dass wir beide unser erstes Berliner Konzert direkt im Großen Saal der Philharmonie gesungen haben.
***
Dann dieser Chor, der in einem der schönsten Kirchen der Stadt probt und so wunderbar klar klingt. Das Repertoire ist anders als alles, was ich bisher kenne, schon nach dem ersten Probenbesuch muss ich Musikbegriffe googeln, die ich noch nie gehört habe. Einige der Sänger komponieren sogar selbst, viele sind musikalisch deutlich fitter als ich, und ich habe total Lust, mich so richtig reinzuhängen und aufzuholen. Nach der Probe stehen wir noch rum, stoßen an, blicken über die Stadt. „Ich kann schon nicht glauben, dass ich hier proben darf“, sagt eine Sängerin, „aber noch weniger, dass ich hier oben Wein trinke.“ Zwei Proben bin ich dabei, finde mich rein, komme schon ganz gut mit – dann kommt die Chorleitung, die vorher auf Reisen war, zurück, und damit hat sich die Sache dann auch erledigt: So unwirsch, so abweisend, so von oben herab – ein Sänger, der unser Gespräch mithört, nimmt mich danach beiseite und sagt Dinge wie „lass dich nicht abschrecken“, „schlechten Tag erwischt“ und „sonst ganz anders“. Mag sein, mag nicht sein. Aber hier bin ich falsch.
***
Vielleicht mal melden bei der Singakademie? Vor Jahren habe ich da schon mal mitgesungen, manche musikalischen Erklärungen des Chorleiters sind mir bis heute im Gedächtnis und immer noch hilfreich. Hätte ich damals schon gebloggt, ihr hättet euch einiges anhören müssen hier, über ein Konzert im Berliner Dom und – die Götter wandeln unter uns – einen Workshop mit dem Hilliard-Ensemble. Kurz hingemailt, schnelle, freundliche Antwort: Ja, gerne vorbeikommen, hier ist schon mal das Programm fürs nächste Konzert, und bitte das verpflichtende Probenwochenende beachten. Klar, dass das an einem Termin liegt, den ich nicht freischaufeln kann. Womit sich auch das erledigt hat.
***
So geht das bis in den Herbst. Ein Kollege erzählt von seinem Chor, bald beginnen die Proben fürs Weihnachtsoratorium, es ist wieder diese Zeit. Jauchzet, frohlocket, aber bei mir ist die Luft raus. Ich bekomme es nicht mal auf die Reihe, den Chorleiter anzumailen.
Warum es dann doch noch geklappt hat? Facebook-Anzeigen-Targeting. Denn dass dieser „sponsored post“ in meiner Timeline auftauchte, kann nur daran liegen, dass ich ein paar Chor- und Musikseiten in Berlin folge: ein Kammerchor in Kreuzberg sucht Verstärkung, das Reperoire klingt so interessant, dass ich ein Vorsingen ausmache und es – trotz Erkältung, trotz fünf Jahren lustig, laut und legato – hinbekomme. Geprobt wird in einer nicht allzu gut geheizten Kirche, unten im Foyer Kerzen und Adventskranz, auf dem Klo erinnert ein Foto von Greta Thunberg daran, das Licht auszumachen.
Oben sitzen wir, der Chorleiter erklärt, wie man einen gregorianischen Gesang liest, der auf vier statt fünf Linien notiert ist, er kommt von Hölzchen auf Stöckchen auf Dorisch auf Phrygisch auf Dinge, die ich zuletzt im Musikschulunterricht gehört habe. „Riecht nach Essen hier, findest du nicht?“, sagt die Frau neben mir. Ja, erklärt jemand, das kommt aus dem Raum hinter der Orgel, wo sonst die Konfirmanden sind, da lebt eine Familie im Kirchenasyl. Auf unserer Seite der Orgel sind wir so wenige, dass man wirklich jede Stimme hört. Kammerchorfreude: auf der einen Seite der Sopran, auf der anderen der Tenor, beide so nah, dass ich mich an ihre Melodien anlehnen kann, zur Orientierung. Ausatmen, einatmen, konzentrieren. Und Musik machen.